
Wir sollten uns wieder daran erinnern: Unsicherheit gehört zum Leben
Rouven Porz ist assoziierter Professor für Medizinethik an der medizinischen Fakultät der Universität Bern. Zusammen mit Hubert Kössler leitet er den Bereich Medizinethik der Insel Gruppe. Wir sprachen mit ihm über seine Arbeit und wie die Pandemie unsere Wertewelt verändert.
25.02.2021
Guten Tag, Herr Porz. Wie und warum wird man Ethiker?
Ethiker zu werden habe ich nicht geplant. Im ersten Beruf war ich Lehrer für Biologie und Philosophie. Meine Doktorarbeit in Philosophie an der Uni Basel hat mich immer mehr zur Frage gebracht, was Philosophie denn praktisch bedeutet – im Alltag der Menschen. Schlussendlich ist die Motivation für die Berufswahl mein Interesse für den Sinn des Lebens. Früher kamen übrigens mehr Ethiker aus der Theologie, heute arbeiten viele Medizinerinnen und Mediziner in meinem Berufsfeld.
Meine Studienaufenthalte in Maastricht und Newcastle haben meine Art und Weise geprägt, Ethik im Spital einzubringen. Gerade in den Niederlanden wurden in der Vergangenheit viele neue Formate dafür entwickelt. Im Spital geht es immer wieder darum, Raum und Zeit zu finden, um Ethik zum Gesprächsthema zu machen. Das Personal hat viel zu tun – man braucht also gute Ideen, wie man Mehrwert bieten kann ohne eine weitere Belastung zu sein.
Wie können wir uns Ihre Arbeit konkret vorstellen?
Ich verstehe mich als Teamplayer, nicht als Moralapostel. Meine Aufgabe ist es, Hilfestellungen zu geben, wenn ethische Fragen auftauchen. Eine typische Situation ist die folgende: Bei einem älteren, schwer kranken Menschen, der sich nicht mehr selbst äussern kann, steht die Frage im Raum, ob man mit lebenserhaltenden Massnahmen weiterfahren oder ob man sie einstellen soll. Manchmal sind Patientenverfügungen unklar oder die Angehörigen sind überfordert mit der Entscheidung. Im Idealfall kontaktiert mich jemand aus dem medizinischen Team und wir suchen dann ein Zeitfenster, in dem sich alle involvierten Ärzt*innen und das Pflegepersonal zu einer Fallbesprechung treffen können. Ich moderiere dieses Gespräch und helfe den Beteiligten, ihre Sicht der Dinge zu formulieren und sich einzubringen. Gemeinsam suchen wir eine Lösung oder treffen eine Entscheidung, wie wir in dieser komplexen Thematik auf die Angehörigen zugehen wollen.
Im Inselspital arbeiten mehr als 10’000 Menschen. Wir versuchen, Ethik als eine Art Weiterbildungsprogramm anzubieten, mit Themen, die für die einzelnen Fachbereiche wichtig sind. In der Gynäkologie geht es häufig um den Lebensanfang, in der Intensivmedizin zum Beispiel um Fragen rund um Transplantationen.
Hat die Pandemie neue ethische Fragen aufgeworfen?
Teilweise schon. Unser westliches Gesundheitssystem stellt eigentlich immer den Patientenwillen in den Vordergrund. Schwierig oder dramatisch wird es dann, wenn sich eine Person nicht mehr oder noch nicht äussern kann. Diese Fälle sind aber nicht neu – Entscheidungen über die Fortsetzung von Therapien oder Triagen werden in der Intensivmedizin immer getroffen und stellen die Ärztinnen und Ärzte nicht vor neue Herausforderungen. Neu aufgrund der Pandemie ist allerdings das starke Interesse der Öffentlichkeit an diesen Prozessen. Es geht nun darum, transparent zu machen, wie man vorgeht.
Neue Fragen in der Ethik entstehen generell, weil heute dank der modernen Medizin fast alles möglich ist. Das stellt Ärzte und Pflegende vor immer schwierigere Entscheidungen. Soll man alles machen, was man tun kann? Heute können Menschen sehr lange am Leben erhalten werden. Wann darf jemand sterben? Diese Fragen bedeuten oft eine Überforderung für Ärzte, Patienten und Angehörige – obwohl wir gleichzeitig sehr dankbar sind für all die neuen Möglichkeiten.
Und in absehbarer Zeit wird noch eine weitere Komponente dazukommen: die künstliche Intelligenz. Algorithmen sollen die Ärzteschaft bei Entscheidungen unterstützen – gerade auch, wenn es um Leben und Tod geht. Noch haben immer die Menschen das letzte Wort. In Bezug auf computerunterstütze Entscheidungen entstehen Ängste, ob denn ein Algorithmus ohne Diskriminierung gestaltet werden kann. Und wie sich die Algorithmen weiterentwickeln, wenn sie selbstständig lernen. Wobei ja alles Neue Ängste schürt: Früher sorgte man sich, ob die Geschwindigkeit beim Zugfahren nicht der Gesundheit schaden könne.
Wurden nicht erst kürzlich die Richtlinien für Triagen geändert?
Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften hat letztes Jahr ihre Richtlinien zu intensivmedizinischen Massnahmen um den Punkt «Triage von intensivmedizinischen Behandlungen bei Ressourcenknappheit» ergänzt. Diese Richtlinien erklären sehr detailliert, wie Entscheidungen nach medizinischen Kriterien gefällt werden. Ganz wichtig: Dabei darf es keine Diskriminierung geben, grundsätzlich werden alle gleich behandelt.
Wie geht es Ihnen und den Mitarbeitenden des Inselspitals aktuell?
Zurzeit besteht eine grosse Unsicherheit, wie lange dieser Ausnahmezustand noch anhalten wird. Aber man spürt auch einen gewissen Stolz, dass wir uns schnell gut organisiert haben und die Situation eigentlich gut meistern. Alle haben Hoffnung, dass es irgendwann wieder anders wird. Zu Beginn der Pandemie gab es viel Angst beim Personal, weil Covid-19 sehr ansteckend ist – zum Beispiel, ob die Schutzkleidung ausreichend schützt. Die Schnelligkeit der Forschung ist sehr hilfreich: Wir wissen heute bereits viel mehr über das Virus als noch vor einem Jahr. Neu für uns als Gesellschaft ist sicher auch, dass die Pandemie ausnahmslos alle betrifft. Ich kann potenziell „Täter“ sein, ohne es je zu erfahren. Die Angst vor der eigenen Schuld ist gross; man könnte zum Beispiel seine Eltern anstecken und dadurch an ihrem Tod mitverantwortlich werden. Und noch etwas ist neu: Es gab wohl noch nie so viele Experten. Die Medien haben das sehr befeuert und zu einer starken Polarisierung beigetragen. Statt bei der Einordnung zu helfen, welche Fakten zuverlässig und wichtig sind, haben sie Komplexität und Überforderung noch verstärkt.
In einem Interview mit der NZZ haben Sie von einem Paradigmenwechsel der Werte gesprochen – von einem Wertekonflikt zwischen Selbstbestimmung und Solidarität. Können Sie dazu ein paar Worte sagen?
Als Präsident der Europäischen Gesellschaft für Medizinethik war ich in den vergangenen Jahren viel unterwegs und konnte die europäischen Kulturen in Bezug auf ihre Werte gut kennenlernen. In der Schweiz wird der Wert der Selbstbestimmung hochgehalten. Jede und jeder kann über das eigene Leben selbst entscheiden. Dazu passt die aktive Beteiligung der Bevölkerung an der Politik durch die direkte Demokratie. Auch als Patientinnen und Patienten möchten wir gerne frei entscheiden und selbst über uns bestimmen können. Die Pandemie brachte nun plötzlich einen neuen Wert an die Oberfläche: die öffentliche Gesundheit. Sie steht immer wieder im Konflikt mit der Selbstbestimmung. Aktuell können wir nicht einfach zum Flughafen fahren, nach Tansania fliegen und den Kilimandscharo besteigen. Der Staat schiebt uns hier einen Riegel vor. Wie können wir nun unsere Selbstbestimmung und die öffentliche Gesundheit unter einen Hut bringen? Plötzlich ist der Begriff der Solidarität ganz wichtig geworden – als Gegenwert zur Selbstbestimmung. Dieser Wechsel in der gesellschaftlichen Wertewelt ist für viele verstörend. In der Schweiz scheint man damit gut umgehen zu können – in anderen Ländern erleben wir mehr Rebellion gegen die Einschränkungen. Eigentlich ist es doch erstaunlich, wie gut wir das schwierige Jahr 2020 hinter uns gebracht haben.
Warum schafft es ausgerechnet ein Land mit hohem Selbstbestimmungs-Bedürfnis, sich den Einschränkungen besser zu beugen?
Das ist eine interessante Frage. Ich denke, die Selbstbestimmung geht einher mit Verantwortung. Man ist in der Schweiz daran gewöhnt, Verantwortung zu übernehmen. Ähnlich, wie wenn in einer Abstimmung Steuersenkungen abgelehnt werden. Die Bevölkerung hat gelernt, sich über Konsequenzen Gedanken zu machen und vorauszuschauen. Man akzeptiert, dass das eigene und das gesellschaftliche Handeln Folgen hat.
Was wünschen Sie sich von Politik und Öffentlichkeit?
Meiner Ansicht nach wurde von der Politik gut entschieden und gut gehandelt. Daher habe ich an die Politik keine Wünsche. Von uns Menschen, allen miteinander, wünsche ich mir, dass wir die Unsicherheit stärker als conditio humana akzeptieren, als Teil unseres Menschseins. Oft haben wir den Eindruck, wir könnten alles planen, alles sei sicher. In der Schweiz hat man es gut geschafft, Unsicherheiten und Komplexität zu kaschieren. Hier ist ja sogar der Tod planbar. Die aktuelle Unsicherheit ist für die Schweiz schwer zu verkraften. Wir sollten uns gegenseitig immer wieder sagen: Unsicherheit gehört zum Leben dazu.

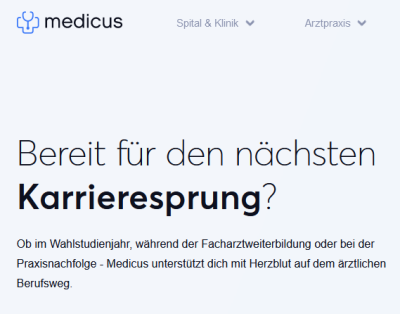

Kommentare
Noch kein Kommentar veröffentlicht.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion