
Was die Isolationsmassnahmen im Spitalalltag bedeuten, kann sich kaum jemand vorstellen.
Für dieses Interview befragten wir eine Oberärztin in einer Deutschschweizer Notfallstation zur aktuellen Lage und wie es ihr und ihrem Team gerade geht.
07.12.2020
Im Spital zu arbeiten, ist aktuell eine Grenzerfahrung. Nach einem strengen Winter 2019 und der ersten Welle, von der wir stärker betroffen waren als andere Spitäler, sind die Schweizer*innen nicht ins Ausland in die Ferien gereist, sondern in die Schweizer Berge. Die Sommersaison war streng und eine Flaute in der Zwischensaison, wie in anderen Jahren, blieb aus. Jetzt sind wir in der zweiten Welle – was bedeutet, seit dem Winter sind wir permanent und pausenlos dran. Ich hatte das Glück, im Herbst zwei Wochen Urlaub zu haben, um Energie zu tanken. Allerdings ist von der Erholung schon nichts mehr zu spüren. Schlussendlich ist es aber eine Frage der Einstellung: Wenn ich trotz Erwartung eines Höllendienstes am Wochenende, wider Erwarten nicht im Spital, sondern zuhause übernachten kann, nehme ich das als positive Überraschung.
Wir denken permanent verschiedene Szenarien durch. Was passiert, wenn wieder Lockerungen eingeführt werden? Bei Szenario A käme bald die dritte Welle, bei B der direkte Übergang in die Wintersaison und C eine Mischung von dritter Welle und Wintersaison.
Im Unterschied zur ersten Welle zerrt diese zweite mehr an den Nerven. Damals wussten wir, dass wir sozusagen einen 400-Meter-Lauf rennen. Zwar streng, aber irgendwann kommt der Sommer und bringt Besserung. Aktuell sind wir wahrscheinlich eher beim Ironman. Oder rennen wir einmal um die Welt? « Nicht zu wissen, wann es besser wird, belastet uns sehr. » Sowohl das Team wie auch die Patient*innen sind gereizt und Corona-müde. Der Zusammenhalt der ersten Welle bröckelt in den Teams. Die Einstellung lautet eher: « Machet dir, mir möge nümm. »
Aktuell arbeite ich noch mehr als sonst an allen Fronten. Natürlich gehen meine üblichen Verantwortlichkeiten als Oberärztin weiter. Bei jedem einzelnen Patienten stellt sich die Frage, ob die Person Corona-positiv sein könnte. Schon beim geringsten Verdacht muss sie zum Schutz aller isoliert werden.
Unser Spital ist nicht gross genug, um das Team in ein Iso- Team und ein reguläres aufzuteilen. Das Personal muss also immer wieder aufs Neue die aufwändige Schutzkleidung anziehen. Was die Isolations-Massnahmen im Spitalalltag bedeuten, kann sich kaum jemand vorstellen, der nicht selbst betroffen ist. Um Viren nicht überall zu verbreiten, kann man nicht schnell mal das Telefon abnehmen oder der Kollegin im Nebenzimmer aushelfen. Bis alles ausgezogen und gründlichst desinfiziert ist, ist man blockiert. Das braucht viel Zeit und eine bessere Organisation. Leider kennen auch Entscheidungsträger diese Umstände oft zu wenig und können das in der Planung nicht vollständig berücksichtigen. « Auf dem Papier sehen die Zahlen gut aus, aber der massive Mehraufwand durch die Isolation von Verdachtsfällen bildet sich in keiner Statistik ab. » Wir geben uns jeden Tag Mühe, dass die Betreuungsqualität nicht unter der Situation leidet. Aber schliesslich führt es halt doch dazu, dass man bei einem isolierten Patienten einmal weniger vorbeigeht. Wenn mehr Patient*innen da sind, hat man für den einzelnen weniger Kapazität. Man muss Abstriche machen.
Das sind alles zusätzliche Stressoren, die den Arbeitsalltag belasten. Dazu kommt die nun wieder höhere Anzahl Patient*innen und die fortwährende Umstrukturierung und Neuorganisation. All das braucht Zeit und Nerven. Mein direkter Vorgesetzter weiss, wo die Tücken und Probleme sind. Er macht genau die gleichen Dienste wie ich. Das macht es einfacher, weil wir am gleichen Strick ziehen.
Bisher mussten wir glücklicherweise noch keine Patienten aus Kapazitätsgründen heimschicken oder ablehnen. Ob eine Person auf die Intensivstation verlegt wird oder nicht, ist ja keine neue Frage. Die gab es auch vor COVID-19 schon häufig. Dabei geht es gar nicht in erster Linie darum, welche Krankheit jemand hat, sondern wie gross die Chancen sind, dass der Patient durch den Aufenthalt auf der Intensivstation in Zukunft eine gute Lebensqualität erreichen kann.
Zum Glück musste ich noch nie eine Triage aufgrund mangelnder Kapazitäten machen. Ich weiss aber auch, dass andernorts die Belastung noch deutlich höher ist. Ich hoffe sehr, dass wir niemals solche Szenen wie in Italien erleben müssen. Ich hoffe auch dass wir weiterhin den gesundheitlichen Bedürfnissen unserer Patient*innen gerecht werden können und keine zu hohen qualitativen Einbusse in Kauf nehmen müssen.

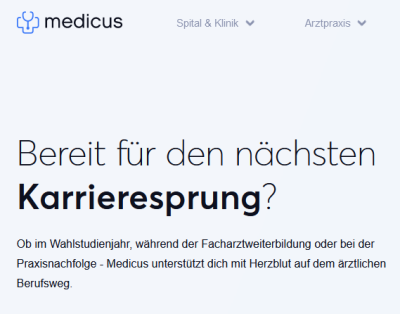

Kommentare
Noch kein Kommentar veröffentlicht.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion