
Covid: Viele haben zum ersten Mal erlebt, wie komplex Forschung ist
"Wir haben als Gesellschaft mehr Mühe, mit den Unsicherheiten umzugehen." Hubert Steinke ist Professor für Medizingeschichte an der Universität Bern. Wir haben ihn gefragt, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es im Umgang mit Pandemien früher und heute gibt.
27.09.2021
Sie haben Medizin studiert, wurden aber nicht Arzt. Warum?
Ich wollte Arzt werden und habe Medizin studiert, aber schon zu Beginn des Studiums wäre das Studium der Geschichte eine Alternative gewesen. Im fünften Studienjahr in der Klinik habe ich realisiert, dass meine Stärken weniger im Umgang mit den Patienten liegen, sondern eher in der Reflexion und der kritischen Analyse. So habe ich das Medizinstudium beendet und dann direkt das Geschichtsstudium angehängt.
Sie haben zwei Doktortitel – Dr. med. und Dr. phil. Braucht man das für eine Professur in Medizingeschichte?
Einige Medizinhistoriker:innen sind Mediziner:innen, andere Historiker:innen, manche sind beides. Es nützt sicherlich, wenn man einen medizinischen Hintergrund hat. Als Professor forsche ich ja nicht nur, sondern unterrichte auch – und dafür ist es wichtig zu wissen, wie Medizinstudierende denken und wie Ärzt:innen ticken.
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus und welche Aufgaben und Ziele haben Sie?
Mein Arbeitsalltag besteht aus drei Teilen: der Forschung, der Lehre und der Leitung des Instituts – ganz klassisch, wie man das eben an der Uni macht. Bei der Forschung kann man selbst Themen wählen, die einen interessieren. Bei der Lehre richtet man sich nach dem Medizin-Curriculum. Das Ziel ist nicht in erster Linie, den Studierenden historische Details zu vermitteln, sondern sie zum kritischen Denken zu animieren. Wir wollen die Geschichte nutzen, um die Medizin besser zu verstehen. Dieser historische Ansatz hilft, weil man etwas Distanz hat und eine breite Perspektive einnehmen kann. Man beobachtet längere Prozesse und kriegt einen Blick dafür, in welchen Prozessen wir heute stehen. So kann man verstehen lernen, was Medizin früher und heute charakterisiert. Und schliesslich kümmere ich mich drittens noch um die Leitung des Instituts inklusive Archiv und Bibliothek. Demnächst geht ein digitales Museum online, an dem wir lange gearbeitet haben.
Es geht weniger um die lokalen Details, sondern darum, an einem konkreten Beispiel zu erklären und aufzuzeigen, was die Medizin ausmacht. Wenn man aber einen Blick auf die lokalen Fakten werfen will, dann müssen wir Albrecht von Haller mit seiner intensiven Forschung im 18. Jahrhundert erwähnen. Er war wohl der bedeutendste Mediziner des 18. Jahrhundert und stammte aus Bern, und hier in Bern bewahren wir denn auch seine Briefe, Forschungsdokumentationen und andere Schriften auf. An ihnen kann man erforschen, wie Medizin damals funktioniert hat.
Welches sind denn die grössten Unterschiede zu heute?
Haller, der Begründer des systematischen Tierversuchs, war zwar Professor, doch seine ganze Forschung erledigte er allein. Er nahm ein Tier, legte es auf den Tisch und untersuchte es. Ein relevanter Unterschied ist deshalb die Institutionalisierung: Ob jemand überhaupt geforscht hat, lag in dieser Zeit vor allem an ihm selbst. Erst im 19. Jahrhundert wurden Unis zu Forschungsanstalten und alles wurde komplexer – deshalb brauchte es Institutionen, die die Forschung tragen. Heute haben wir diese grossen Institutionen und teilen die Arbeit auf. Bei Covid sehen wir das sehr deutlich: Die Dimensionen haben extrem zugenommen, es gab vielfältige internationale Kooperationen. Selbst das grosse Inselspital in Bern ist zu klein für klinische Studien und arbeitet deshalb mit anderen zusammen.
Was muss man zur Berner Medizingeschichte wissen?
Die Frage ist eher: Muss man in Anbetracht der Internationalität der Medizin überhaupt etwas dazu wissen? Trotzdem gibt es lokale Traditionen, deren Kenntnis hilfreich ist. In Bern gibt es z.B. seit dem frühen 20. Jh. eine enge Zusammenarbeit mit der Industrie. Ein Beispiel dafür ist Theodor Kocher, der Nobelpreisträger, welcher Forschung zur Schilddrüse betrieben und chirurgische Instrumente entwickelt hat. Ein Instrument, das wir heute noch verwenden, ist die sogenannte Kocher-Zange. Dann gab es in den 50er-, 60er-Jahren Maurice Müller, den Pionier der Osteosynthese. Seine Arbeit hat die Medizin geprägt: Während vorher alle ein wenig anders operiert hatten, wurde Müllers Vorgehen zum weltweiten Standard.
Wir interessieren uns dabei aber weniger für die Person selbst, als wofür sie steht. Dies gilt auch für Institutionen. Im Oktober eröffnen wir unser digitales Museum über das Inselspital. Daran zeigen wir die weltweite Geschichte, wie sie sich im Inselspital darstellt. Wir sind hier in der westlichen Kultur verankert – bei uns geht vieles genau gleich zu und her wie zum Beispiel in Berlin.
Zurück zur Pandemie: Die Menschheit hat in ihrer Geschichte immer wieder Seuchen erlebt. Was wiederholt sich bei Covid, was ist anders?
Die Hauptunterschiede sind die Globalisierung und die Geschwindigkeit der Ausbreitung der Krankheit. Zwar war auch die Pest ein globales Phänomen, doch wie andere frühere Seuchen kam sie langsam und ging auch wieder langsam. Ab Mitte des 14. Jahrhunderts wütete sie in Europa und es gab bis ins 17. Jahrhundert immer wieder Ausbrüche. Die Menschen zu dieser Zeit lernten, sich zu schützen. Im 18. Jahrhundert erfuhr man in Bern aus Briefen von einem Pestausbruch in Russland. Da bat der Berner Sanitätsrat Haller, nachzufragen, was los sei – weil er weltweit vernetzt war. Man beschloss Vorsichtsmassnahmen für den Fall, dass die Krankheit näherkommen sollte. Schon im 15. und 16. Jahrhundert wurden bei Ausbrüchen von Pest die Stadttore geschlossen und der Handel unterbunden – wie in einem Lockdown. Obwohl es im 17. und 18. Jahrhundert keine grösseren Ausbrüche mehr gab, erinnerte sich das kollektive Gedächtnis daran, was zu tun war.
Denn warum haben wir zu Beginn der Covid-Pandemie zögerlich reagiert? Weil wir Pandemien nicht mehr im kollektiven Gedächtnis haben. Wenn in 20 Jahren eine nächste Pandemie kommen sollte, wären wir wohl besser vorbereitet und würden uns schneller schützen. Und bereits heute werden überall Szenarien für künftige Pandemien ausgearbeitet – genau so hat man das auch zu Pestzeiten gemacht. Und spannend ist auch: Die asiatischen Länder haben auf Covid ganz anders reagiert, weil sie von der SARS-Pandemie von 2002/2003 geprägt waren.
Die Medien und die Öffentlichkeit vergleichen Covid häufig mit der Spanischen Grippe. Da diese allerdings während des Kriegs auftrat, brannte sie sich nicht so dominant in das kollektive Gedächtnis ein. Und sie war damals auch nicht das Hauptthema in der journalistischen Berichterstattung – der Krieg selbst spielte in den Zeitungen eine wichtigere Rolle, obwohl mehrere Tausend Menschen in der Schweiz an der Spanischen Grippe starben.
Der zweite grosse Unterschied ist die Geschwindigkeit, sowohl in der Verbreitung wie auch in der Therapie. Dabei haben wir Glück, dass man gegen das Coronavirus überhaupt eine Impfung entwickeln kann – gegen Aids haben wir bis heute keine.
Die Frage ist ja stets: Wie reagieren Menschen auf Epidemien? Es gibt dabei immer zwei Seiten. Einerseits gibt man anderen die Schuld – zum Beispiel einer bestimmten Gruppe – und schützt sich selbst. Anderseits führen Epidemien zu starker Solidarität. Auch heute sehen wir beides. Das Ausland beschwert sich zum Beispiel über die schwachen Massnahmen in der Schweiz. Oder Trump bezeichnet die Krankheit als «China-Virus». Während der Pest gab man den Juden die Schuld und behauptete, sie hätten Brunnen vergiftet, diesen Sommer müssen die «Balkanrückkehrer» herhalten. Auch die Spanische Grippe wütete längst nicht nur in Spanien … In den betroffenen Regionen sehen wir heute aber starke Solidarität – mit Nachbarschaftshilfe oder Suppenküchen unterstützen sich die Menschen gegenseitig.
Allerdings sind die Reflexe der Schuldzuweisung heute nicht mehr so krass wie früher. Damals wusste man nichts über Bakterien oder Viren. Heute dominiert die naturwissenschaftliche Erklärung. Früher konnte die Bevölkerung die medizinischen Ausführungen nicht verstehen – die aus heutiger Sicht ausserdem falsch waren. Heute diskutieren ganz normale Menschen zum Beispiel über den R-Faktor. Alle sind Expert:innen, und im Internet findet man eine Bestätigung für jede noch so verrückte Idee. Damals hingegen hatte man in der Regel eine oder vielleicht zwei Tageszeitungen und keine weiteren Informationsmöglichkeiten. Auch früher waren manche Menschen kritisch, aber heute werden alle Autoritäten stärker hinterfragt – viel stärker als vor den 1970er-Jahren.
Wenn es um die Wirkung von Impfungen geht, ist das Bild der Kranken unter den Eisernen Lungen sehr prägend. Erinnern wir uns als Gesellschaft zu wenig an solche Bilder?
Polio, also Kinderlähmung, trat um 1950 vermehrt auf und traf auch Kinder. Sobald Kinder betroffen sind, lösen Krankheiten stärkere Ängste aus. In dieser Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die westliche Welt einen grossen Aufschwung: Die Forschung machte riesige Fortschritte und die Bevölkerung hatte grosses Vertrauen in die Naturwissenschaften. Im Gegensatz dazu betrifft Covid besonders Personengruppen, die wir nicht sehen, weil sie in Pflegeheimen leben und «eh bald sterben» – das sind völlig andere Bilder. Wir sahen Bilder von überfüllten Intensivstationen in Norditalien und überfüllte Krematorien, die für viele üblicherweise weit weg sind. Dazu kamen Meldungen, das seien Fake News, oder Videos von Menschen in Kliniken, die diese Situationen dementierten. Ausserdem sind wir an Bilder von Menschen auf einer Intensivstation gewöhnt, das ist nichts Neues. Dass mehr Menschen auf der Ips liegen, lässt sich nicht in so intensiven Bildern zeigen wie mit der Eisernen Lunge – damals mussten Menschen oft nur zwei oder drei Tage in das Beatmungsgerät und dann waren sie gerettet. Eine Impfung ist viel komplexer. Viele Menschen haben in den vergangenen Monaten zum ersten Mal wirklich erlebt, wie komplex Forschung ist. Normalerweise wird im stillen Kämmerchen geforscht, dann gibt es Resultate und die werden der Öffentlichkeit dann präsentiert. Bei Covid hingegen gab es Neuigkeiten im Sekundentakt. Zitate und Studien wurden veröffentlicht, bevor sie geprüft waren. Doch Forschung braucht Zeit, um sich zu stabilisieren. Wissen braucht Zeit, bis es stimmt, und damit sind wir als Gesellschaft überfordert. Es entsteht das Gefühl: Die widersprechen sich, das stimmt alles nicht! Das ist für uns als Gesellschaft eine neue Erfahrung.
Würde es helfen, sich bei der Impffrage stärker mit geschichtlichen Aspekten zu befassen?
Ja, das wäre gut, dann wären die Reaktionen vielleicht weniger ideologisch. Heute bilden sich zwei Lager, die gar nicht mehr miteinander reden können und die sich gegenseitig «in eine Ecke stellen». Die einen sagen, impfen sei Zwang, die anderen, Impfgegner seien dumm. Die Geschichte kann helfen, das rationaler zu sehen. Es gibt Argumente für und gegen die Impfung. Das ist nicht schwarz und weiss, sondern ein fliessender Übergang. Ich persönlich bin überzeugt, dass die Argumente für die Impfung deutlich überwiegen, aber sehe auch, warum andere anders gewichten.
Seit es Impfungen gibt, gibt es Kritik daran – heute ist sie aber durch die Globalisierung und die Medien viel stärker sichtbar. Dabei spielt der drohende Impfzwang eine wichtige Rolle. Zu Ende des 19. Jahrhunderts hat die Schweiz über ein Gesundheitsgesetz mit Impfzwang abgestimmt. Es wurde mit 80 Prozent abgelehnt. Die Bevölkerung wollte den Zwang nicht. Das ich auch heute nicht grundsätzlich anders.
Was heute hingegen deutlich anders ist als früher, ist dieses absolute Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Ein Beispiel: Die Pockenimpfung im 19. Jahrhundert war damals wirklich mit grossen Risiken verbunden. Man konnte die Pocken bekommen und nach der Impfung sterben. Trotzdem hat sich die Mehrheit der Menschen impfen lassen, weil sie die Gefahr der Erkrankung höher einschätzten.
Heute haben wir irrsinnig viel höhere Anforderungen: 100 Prozent Schutz ist gefragt.
Menschen wollen sich nur impfen lassen, wenn ihnen garantiert gar nichts passieren kann. Diese Sicherheit kann die Medizin aber nicht geben, denn Medizin ist keine Mathematik. In einem von 100 000 Fällen taucht ein Problem auf. Ja, es kann sehr selten schwere Nebenwirkungen geben, aber das Risiko ist verschwindend gering im Gegensatz zu früher. Wir haben als Gesellschaft mehr Mühe, mit den Unsicherheiten umzugehen. Die Geschichte könnte helfen, das in ein sinnvolles Verhältnis zu setzen. Auch hier gibt es nicht einfach schwarz oder weiss, sondern wir brauchen eine differenzierte Betrachtung: Wie ist das Risiko im Verhältnis?
Die historische Perspektive könnte uns vielleicht etwas Demut lernen – und Dankbarkeit dafür, wie unheimlich gut es uns heute geht. Schon die letzten 30 Jahre Medizingeschichte haben so viele neue Möglichkeiten nur allein in der Krebstherapie gebracht, Behandlungen, die vor ein paar Jahrzehnten noch undenkbar waren. Aber auch heute kann die Medizin nicht alles.
Letztlich geht es um Vertrauen – auch bei mir. Obwohl ich Medizin studiert habe, muss ich am Ende der Forschung vertrauen. Das ist auch bei Hausärzt:innen so – sie können zwar Studien lesen und verstehen, aber nicht beurteilen, ob sie auch stimmen. Es ist wie bei einem AKW: Da kann ich auch nicht einschätzen, ob der Bau sicher ist oder nicht. Im Grunde genommen geht es um das Infragestellen von Expert:innen. Früher hatten wir eine paternalistische Medizin: Der Arzt sagte «den Kindern», wo es langgeht. Das wollen wir heute zu Recht nicht mehr. Auch dass die Medizin selbstkritischer ist, ist gut. Am Ende bleibt aber nur das Vertrauen.

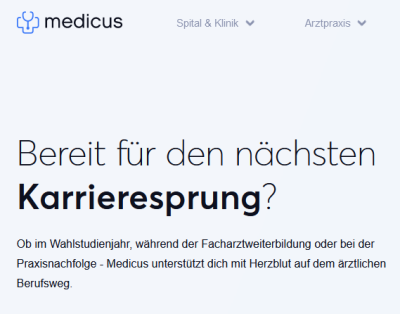

Kommentare
Noch kein Kommentar veröffentlicht.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion