
Unsere Opfer sollen nicht umsonst gewesen sein
Interview mit einer Spitalfachärztin über ihre Erfahrungen in den Zeiten von Corona. #Ärztealltag
11.05.2020
“Persönlich fällt mir während der Coronazeit vor allem auf, dass ich mich selbst und mein Leben durch die entstandene Ruhe hinterfrage. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Worum sorge ich mich? In der ersten Zeit hat mir die Situation Angst gemacht – ich sorgte mich um meine Familie, um die Patienten, um die Menschheit im Allgemeinen. Der Abstand zu Konsum und zur Hektik des normalen Alltags, die Entschleunigung und Ruhe gaben mir Zeit, über diese Dinge nachzudenken und ich glaube, diese Stille tut unserer Gesellschaft gut.
Als Mutter war ich durch die Schliessung der Schulen organisatorisch stark gefordert. Da wir “Stay home” sehr ernst genommen haben, kam Fremdbetreuung für uns nicht in Frage. Mir ist bewusst geworden, was Lehrpersonen alles leisten, vor allem, mit welcher Geduld sie ihre Aufgaben erledigen. Mein Aufgabenheft wurde durch das Home Schooling noch vielfältiger und vor allem herausfordernder. Ich weiss nicht, ob ich meinen Kindern da gerecht wurde.
Im Spital konnten wir uns gut auf den Ausbruch der Krankheit vorbereiten. Durch das Wissen um die Entwicklungen in China, Italien und im Tessin durchdachten wir verschiedene Szenarien. Es war zwar trotzdem unklar, was bei uns passieren würde, aber wir verfügten über einen gewissen Vorsprung. Die Ungewissheit löste jedoch viel Stress aus. Was, wenn sich zum Beispiel die Hälfte des Personals anstecken würde? Schliesslich trat das Gegenteil der Befürchtungen ein: die Wochen Ende März waren die ruhigste Zeit, die ich im Spital je erlebt habe. Wir sind, im Gegensatz zu anderen Regionen, vom grossen Ansturm verschont geblieben – auch, weil wir im Kanton Bern auf sehr viele Spitäler zählen können und diese rechtzeitig leeren konnten. Daher verteilten sich die Patienten gut. Und deshalb beschämte mich der Applaus auf den Balkonen – eigentlich hätte er anderen Menschen gelten sollen, Lehrpersonen, dem Personal im öffentlichen Verkehr, all den Verkäuferinnen, Lieferanten und Lagermitarbeiterinnen…
Die Kehrseite: Wir haben als Spital in dieser Zeit ziemlich Minus gemacht. Es bleibt sehr zu hoffen, dass dies nicht zu einer weiteren Streichung von Stellen führen wird. Zeitweise gab es wegen der geringen Anzahl Patienten zu wenig Arbeit für die Assistenzärzte. Sie konnten häufig früh nach Hause gehen und Überstunden kompensieren, ihre geplanten Ferien mussten sie jedoch trotz Reisebeschränkungen beziehen. Alle haben diese Entscheidungen mitgetragen und waren jederzeit bereit, sich anzupassen – an neue Arbeitspläne, an mehr oder weniger Einsätze. Auch an die Arbeit auf dem Covid-Track, was wohl bei allen zu Beginn Ängste ausgelöst hat. Diese Flexibilität und Solidarität haben mich sehr berührt. Alle hätten auch sofort mehr geleistet als üblich, wäre es nötig geworden.
Ich erinnere mich gut an den Dienst am Sonntagmorgen, als ich dem ersten Covid-Patienten gegenüberstand – und merkte, dass auch dieser 75-jährige Herr einfach ein kranker Mensch wie all unsere anderen Patienten war. Heute sind wir auf der Corona-Station mit Bedacht, aber ohne starke Schutzausrüstung unterwegs: Wichtig bleiben natürlich weiterhin eine konsequente Händedesinfektion, Distanz und eine chirurgische Schutzmaske. Erst direkt am Bett oder dann an der Beatmungsmaschine arbeiten wir mit stärkeren Sicherheitsvorkehrungen wie Schutzanzügen und Brillen. Meines Wissens hat sich auf unserer Abteilung vom Spitalpersonal niemand im Dienst angesteckt, weil wir die Massnahmen ernst genommen und alle Sicherheitsvorkehrungen in der ersten Zeit immer wieder aufs Neue repetiert haben.
Inzwischen kehrt langsam wieder der Courant normal ins Spital ein. Die Patienten auf der Corona-Station werden langsam weniger, in der normalen Bettenstation füllt es sich wieder. Allerdings werde ich die Sorge nicht los, dass die zweite Welle noch kommen wird. Wir müssen weiterhin grosse Anstrengungen unternehmen, um die Risikopatienten und auch uns zu schützen. Viele Menschen verhalten sich schon seit dem Bekanntwerden der Lockerungen wieder wie vorher. Das mit der Eigenverantwortung scheint in der Schweiz nicht wirklich zu funktionieren. Eine Marktfrau hat mir erzählt, dass viele Menschen (vor allem ältere Männer), die Distanzabsperrungen, die sie mit grünen Harassen um den Marktstand gebaut hat, lächerlich finden. Viele tragen auf diese Weise wohl ihre Ängste nach aussen und entblössen ihre egoistische Art zu denken.
Meiner Ansicht nach ist die Maskenpflicht in der gesamten Bevölkerung keine gute Idee: Sehr viele Menschen, die ich mit Maske auf den Strassen und in den Läden sehe, tragen sie falsch: Die Nase liegt frei, sie fassen sich ins Gesicht, nehmen die Maske ab und ziehen sie wieder hoch. Das korrekte Anlegen und Tragen einer Maske will gelernt sein. Ansonsten kann einen die Maske in einer trügerischen Sicherheit wiegen und zu Unvorsichtigkeit verleiten, insbesondere, nicht mehr auf die benötigte Distanz zu achten.
Besonders gefreut habe ich mich über all die Initiativen von jungen Menschen, die von den Älteren oft als verlorene “Handy-Generation” abgetan werden. Sie haben so viel Solidarität spüren lassen, Aktionen auf die Beine gestellt, Hilfe angeboten. Es wäre super, wenn wir diesen Gemeinschaftssinn beibehalten könnten. Es soll nicht umsonst gewesen sein, was wir als Gesellschaft auf uns genommen und welche Opfer wir in den letzten Wochen gebracht haben. Dabei ist es jetzt ganz wichtig, dass wir uns alle weiterhin konsequent an die Regeln halten: Distanz, Händehygiene und Geduld sind die wichtigsten Elemente der nächsten Wochen und Monate!”

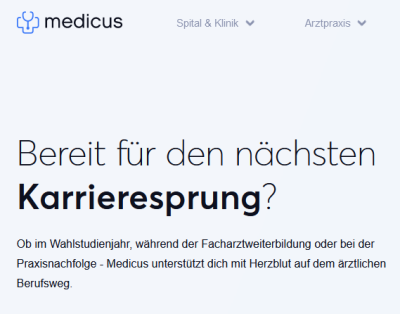

Kommentare
Noch kein Kommentar veröffentlicht.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion