
Pensum und Anforderungen sprengen unsere Kapazitäten
Ein Gedankenaustausch zwischen einer angehenden Psychiaterin und einem Hausarzt in einer städtischen Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin.
08.01.2021
Ein Gedankenaustausch zwischen einer angehenden Psychiaterin und einem Hausarzt in einer städtischen Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin.
Was hat sich an eurem Alltag durch die Pandemie verändert?
Psychiaterin: Da in der Psychiatrie die Kommunikation eine zentrale Rolle spielt, ist die Maskentragepflicht eine grosse Herausforderung. Die Mimik der Patient*innen zu lesen ist für uns wichtig. Gerade bei Menschen, die wir noch nicht kennen, macht die Maske den Beziehungsaufbau komplizierter. Gespräche mit Familienangehörigen, den Arbeitgebenden oder mit der IV können – wenn überhaupt – nur sehr limitiert stattfinden. Auch Heimurlaube im stationären Setting können oft nicht durchgeführt werden, Gruppentherapien nur begrenzt. Diese Therapieeinschränkungen haben zur Folge, dass wir für die Patient*innen weniger tun können als sonst.
Hausarzt: In der ersten Phase waren die ständigen Veränderungen in Bezug auf Material, Schutzkonzepte und Logistik unsere grössten Herausforderungen. Jetzt, wo wir darin fast schon routiniert sind, läuft es in der Praxis wieder geordneter. Aber fast jeder Dienst stellt uns vor neue Herausforderungen. Meine Kollegin wurde am vergangenen Wochenende siebzig Mal angerufen – etwa 90 Prozent der Anrufe drehten sich um COVID-spezifische Fragen. Es ging zum Beispiel um Themen wie: «Meine achtjährige Tochter ist krank und ihre Lehrerin wurde vor einiger Zeit wegen Krebs behandelt. Darf mein Kind zur Schule gehen?» Dieses Pensum und die Anforderungen sprengen unsere Kapazitäten. Eine grosse Schwierigkeit sind auch die kantonalen Unterschiede bei den COVID-Massnahmen. Oft erfahren wir Hausärzt*innen zu spät von Änderungen. Das bringt einiges an Frustration mit sich.
Wie erlebt ihr zurzeit den Umgang mit euren Patient*innen?
Psychiaterin: Alle sind belasteter, das ist wahrscheinlich überall so. Wie gesagt, sind die Therapieangebote limitierter, man hat weniger zeitliche, aber auch personelle Ressourcen. Bei Krankheitsausfällen müssen Gespräche verschoben werden. Von den Patient*innen ist viel Flexibilität gefragt. Da wir aber punkto Pandemie alle im gleichen Boot sitzen und unsere Limitationen für die Patient*innen dadurch greifbarer sind, verschwimmt zumindest in diesem Punkt eine klare Trennung von Hilfeleistenden zu Hilfesuchenden. Nicht selten habe ich den Eindruck, dass unsere Patient*innen diese Situation als Chance nutzen: sie aktivieren ihre Kräfte, bieten uns ihre Hilfe an oder übernehmen selbst mehr. Eine Art Empowerment, das den Patient*innen neue Möglichkeiten eröffnet.
Hausarzt: Ich habe den Eindruck, dass sich meine Patient*innen generell weniger oft in der Praxis vorstellen als vor der Pandemie. Wenn sie kommen, entschuldigen sie sich, dass sie meine Zeit in Anspruch nehmen und sind extrem dankbar. Fast niemand beginnt von sich aus, über COVID zu reden. Doch wenn man ihnen die Möglichkeit dazu bietet, sind die Leute sehr redselig – vor allem diejenigen, die nicht viele Möglichkeiten zum Austausch haben. Dann kommen häufig Ängste, Wut und Frustration zum Vorschein. Ich finde es wichtig, diese Plattform zu bieten und den Leuten zu zeigen, dass sie uns auch mit diesen Themen aufsuchen dürfen.
Sind die Fragen und Probleme anders als vor der Pandemie?
Psychiaterin: Zumindest in der ersten Welle hatte ich das Gefühl, dass viel mehr Menschen als sonst mit psychotischen Beschwerden vorstellig wurden. Vielleicht handelte es sich dabei um Leute, die schon länger unter einem knapp kompensierten oder bislang unbemerkten Wahn gelitten haben und dann im Rahmen des Lockdowns plötzlich auffällig wurden. Der Wahn ist jedoch überraschenderweise kaum von COVID-19 geprägt. Es ging nur selten um Ansteckungsangst oder Verschwörungstheorien. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ein Wahn ja nur dann auffällt, wenn man mit bestimmten Theorien stark aus einer Gruppe heraussticht. Mag sein, dass man beispielsweise zu verschwörungstheoretischen Wahninhalten aktuell immer jemanden findet, der dieses Gedankenkonstrukt teilt und man daher nicht auffällt.
Hausarzt: Man würde ja meinen, es stellten sich viele Leute mit COVID- Angst vor. Aber nur eine Minderheit der Patient*innen führt das als expliziten Konsultationsgrund an. Leute kommen mit den üblichen Themen: Bluthochdruck, Routinekontrollen. Aber nicht selten reden sie dann die meiste Zeit doch über COVID. Mir fällt auch auf, dass viele Leute sich mit diffusen, teils psychosomatischen Beschwerden vorstellen. Wenn man sie genauer befragt, stehen dann oft COVID-19-spezifische Ängste im Raum und das Problem, mit niemandem sonst reden zu können.
Wie zentral sind COVID-19-bezogene Themen bei Patient*innen mit psychiatrischen Fragestellungen?
Psychiaterin: Zentrale Aspekte in einer psychiatrischen Tagesklinik sind die Organisation und Umsetzung einer Tagesstruktur, Arbeitsversuche mit dem Ziel einer Arbeitswiederaufnahme und die Vernetzung mit externen Stellen wie der IV, dem Sozialamt oder Unterstützungsangeboten. Aktuell sind wir hier stark eingeschränkt, was Patient*innen im Fortschreiten der Therapie hindern kann. Das ist für Betroffene belastend und fühlt sich wie ein Abwarten an. Die Situation ist schwierig zu kontrollieren oder zu beeinflussen.
Hausarzt: Die Situation ist für alle Patient*innen schwierig. Homeoffice macht unheimlich vielen Menschen zu schaffen. Wenn sie allein sind, ist die Einsamkeit ein Problem. Aber auch wenn sie mit der Partnerin oder dem Partner oder einer ganzen Familie zu Hause sind, ist es nicht unbedingt einfacher. Latente Konflikte kommen spätestens jetzt ans Tageslicht. Es fehlen Ventile zum Ausgleich. Manch einer wünscht sich, wieder ins Büro gehen zu können. Einer meiner Patienten bezahlt dafür, mitten in der Nacht im Fitnessstudio alleine trainieren zu dürfen. Er befürchtet, sonst «durchzudrehen».
Was sind aus eurer Sicht die Gründe für diese Belastungen?
Psychiaterin: Wo dysfunktionale Dynamiken in Familien, Teams oder auch im Leben einer Einzelperson zuvor durch Sport, Kultur oder soziale Anlässe ausgeglichen werden konnten, ist die Krise Katalysator der chronischen Probleme. Es fehlen die Ventile. Nun kippen Situationen, in denen vorher ein fragiles psychokörperliches Gleichgewicht gehalten werden konnte.
Hausarzt: Der Rhythmus fehlt, man hockt den ganzen Tag im Pyjama vor dem Computer und versucht neben spielenden Kindern zu arbeiten. Viele Leute sind deprimiert und müde. Ängste kommen auf. Darüber wird selten geredet. Bei vielen Patient*innen spüre ich grosse Wut und eine vorher nicht dagewesene Revolte.
Wie geht es euch in dieser Situation?
Psychiaterin: Ich selbst fühle mich durch den reduzierten sozialen Ausgleich belastet, auch mir fehlen Ventile. Die Geschichten der Menschen gehen einem näher, abschalten fällt schwerer. Überall, auch beim Austausch mit Freunden und Familie, schwingt eine gewisse Schwere mit und mir fehlt die körperliche Nähe und Unbeschwertheit. Ich muss mich in Acht nehmen, den Blick nicht nur auf die Probleme und Ungewissheiten zu richten, sondern offen zu bleiben für neue Möglichkeiten und für die Dinge, die uns diese »Krisensituation» lehrt.
Hausarzt: Während der ersten Welle nahmen einige meiner Praxiskolleg*innen die Hygienemassnahmen und unsere aufklärende Rolle gegenüber den Patient*innen nicht sehr ernst. Ich hatte das Bedürfnis, die anderen zu überzeugen und alles zu organisieren, was mich stresste. Ich konnte deshalb nicht mehr schlafen, war überlastet und angespannt. Jetzt, wo es in unserer Praxis besser organisiert ist, spielen auch bei mir die mangelnden Ressourcen und Entspannungsmöglichkeiten – insbesondere im Privatleben – eine Rolle. Zudem macht es nicht gerade Hoffnung, wenn man aus dem Fenster schaut und alles grau ist. Etwas sehr Positives hat das Ganze jedoch für mich. Ich habe in diesem Jahr viel über mich und meine Belastbarkeit gelernt. Vor allem auch darüber, wie belastbar ich sein möchte und wozu ich nicht bereit bin. Dadurch habe ich für mich und mein Leben einige grössere Entscheidungen getroffen, insbesondere in Bezug darauf, wo es beruflich hingehen soll und wo nicht.
Hat sich in eurem Team während der Pandemie eine neue Dynamik entwickelt?
Psychiaterin: Gerade für die Pflegefachleute ist die Situation sehr stressig. In der Tagesklinik haben wir zwei Gruppen gebildet, eine für den Morgen, eine für den Nachmittag. Beim Schichtwechsel muss alles desinfiziert werden und es gibt zweimal Mittagessen. Die Patient*innen können nur halbe Tage vorbeikommen. Das lässt weniger Spielraum für den Austausch zwischen den Patient*innen und mit dem Gesundheitspersonal. Die grössten Kämpfer*innen im Team, welche schon vor der Krise an die Grenzen ihre Belastbarkeit kamen und versucht haben, alle Probleme aufzufangen, fallen jetzt teilweise durch Überlastung aus. Obwohl sich andere bemühen, die entstandenen Lücken zu füllen, stösst das gesamte Team nun stark an seine Grenzen.
Hausarzt: Es entstanden Konflikte, weil nicht alle in unserer Praxis die Abstandsregeln und Hygienemassnahmen punkto COVID gleich streng umsetzen wollten. Im Oktober hatten wir dann vier COVID-Fälle im Team. Das verursachte viel Stress und Angst. Wir haben uns nun gemeinsam auf Massnahmen geeinigt, die für alle gelten. Dadurch ist eine neue Dynamik entstanden und hat unseren Teamgeist gestärkt.
Was wünscht ihr euch und euren Patient*innen im Umgang mit der Pandemie?
Psychiaterin: Viele wünschen sich den «Normalzustand» zurück – damit meinen sie, so, wie es vor der Krise war. Doch wird man nicht selbst, wird nicht das ganze System beziehungsweise die Gesellschaft durch die Krise geprägt und verändert? Ich denke, wer die Vergangenheit zurück will, kann eigentlich nur enttäuscht werden. Ich würde uns und unsere Patient*innen eher dazu ermutigen, neue Wege zu suchen. Es geht nicht darum abzuwarten, bis wir das Alte wiederherstellen können. Es geht doch eher darum, Neues zu schaffen, offen für alternative Wege zu sein und das Wohlbefinden bereits jetzt wieder in die eigenen Hände zu nehmen.
Hausarzt: Ich versuche nicht, den Menschen Hoffnung zu machen. Ich versuche, das Schwierige mit ihnen auszuhalten. Ich weiss auch nicht, wie es weitergeht. In diesem Sinne kann ich niemanden beruhigen. Als meine Aufgabe sehe ich es, das Schwierige mit meinen Patient*innen zu ertragen und nicht wegzuschauen. Die Krise wird nicht schnell vorbeigehen, wir müssen damit leben. Ich wünsche uns allen die Kreativität, nicht immer auf etwas Neues – wie die Impfung, die Wiederaufnahme der Arbeit, die neuen Regeln der Regierung – zu warten, sondern uns innerhalb der sich verändernden Welt anzupassen und weiterzuleben.

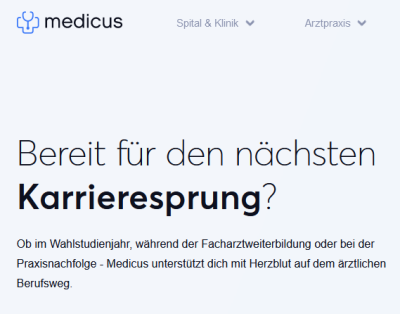

Kommentare
Noch kein Kommentar veröffentlicht.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion