
Nach der ersten Welle füllten sich die Spitäler mit entkräfteten Menschen
Betagte Menschen sind von Covid-19 besonders gefährdet. Wir sprachen mit Daniel Andres, Assistenzart Geriatrie, über die Folgen der Pandemie für seine Patientinnen und Patienten. Und was wir für die Zukunft daraus lernen können.
16.03.2021
Sie beschäftigen sich mit Altersheilkunde. Wie haben Seniorinnen und Senioren auf die Pandemie reagiert?
Senioren haben, wie alle Menschen, sehr unterschiedlich reagiert. Generell kann man sagen, dass sie sich zum Beginn der Pandemie viele Sorgen gemacht haben und verängstigt waren. Damals gab es grosse Zweifel und viel Skepsis – es handelte sich um ein neues Krankheitsbild, welches betagte Menschen besonders schwer treffen konnte – das hat viele überrumpelt. Insgesamt war ich sehr überrascht, wie gut sich die meisten in kürzester Zeit informiert haben und sich auch weiterhin auf dem Laufenden halten. Viele sind bestens informiert über die aktuellen Entscheidungen der Politik oder die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft.
Zu Beginn hatten viele betagte Menschen die Einstellung “Dann nimmt es mich halt!” Sie wollten lieber auf Massnahmen und Behandlungen verzichten. Aber das funktioniert nicht so einfach, man kann sich ja nicht auf die Stirn tätowieren lassen, dass man keine Behandlung will. Mancher dachte: “Wenn ich mich jetzt so stark einschränken muss, dann lohnt sich das Leben nicht mehr. Also will ich die Zeit, die mir bleibt, lieber geniessen und mit den Konsequenzen leben.” Das hat sich verändert, als man realisierte, wie unschön es ist, an Covid-19 zu sterben.
Insgesamt scheint mir, dass der Generationenkonflikt in der zweiten Welle wesentlich weniger stark war als in der ersten. Im Sommer haben viele verstanden, dass einen Covid-19 auch im Alter von 40 oder 45 Jahren schwer treffen kann, dass auch junge Menschen schwere Langzeitfolgen erleiden oder dass die eigenen Eltern schwer erkranken können. Die Krankheit ist für alle spürbarer geworden und damit hat die Solidarität zugenommen.
Wie wirkt sich eine Quarantäne auf einen demenzkranken Menschen aus?
Quarantäne, Isolation oder auch ein Lockdown wirkt sich auf Menschen mit kognitiven Störungen besonders einschneidend aus. Sie können beispielsweise die Massnahmen nicht nachvollziehen und ihnen fehlen Aktivitäten, regelmässige Therapien und persönliche Kontakte ganz besonders. Dieser Mangel verstärkt die Symptome. Bei gewissen Menschen kam dadurch eine vorbestehende, aber gut kompensierte demenzielle Erkrankung erst richtig zum Vorschein, vielleicht auch verstärkt durch den Stress. Das war bei Menschen der Fall, die im Alltag vorher nur wenig beeinträchtigt waren und denen eine regelmässige oder punktuelle Unterstützung durch ihr Umfeld reichte, um ihr Leben meistern zu können. Für sie hatte der Wegfall dieser Unterstützung oft weitreichende Konsequenzen – weil es dann alleine nicht mehr ging und sie mit dieser Tatsache konfrontiert wurden.
Was heisst das für zukünftige Pandemien in Bezug auf ältere Menschen?
Wir müssen ein System entwickeln, wie ältere Generationen Betreuung und Kontakt über digitale Wege erhalten können – zum Beispiel eine Bewegungstherapie per Videocall. Für junge Menschen war es einfach, ihre Kontakte virtuell zu pflegen. Diese Möglichkeiten müssen wir älteren Menschen zur Verfügung stellen und zugänglich machen. Das wäre zum Beispiel eine Aufgabe für Altersheime: Statt von einem Tag auf den anderen Besuche und Therapien ersatzlos zu streichen, sollten diese in virtuelle Formate überführt werden. Beeinträchtigte und ältere Menschen brauchen vielleicht jemanden, der den Computer für sie aufstellt, installiert und bedient. In vielen Fällen haben das Familienangehörige übernommen. Es gibt aber Senioren, die niemanden haben, der das für sie erledigen könnte. Denen müssen wir helfen.
Wie waren die Auswirkungen der Pandemie auf Menschen, die eine ältere Person bei sich zuhause haben?
Personen, die sich um betagte Familienangehörige kümmern, haben wohl unter der Pandemie am meisten gelitten. Sie haben sich selbst stark eingeschränkt, weil sie keine Ansteckung verantworten wollten. Andererseits kamen sie schnell in die Überforderung, da kaum mehr Hilfe von aussen da war und sie mit der Pflege der Angehörigen alleine waren. Während der ersten Welle und der damals herrschenden Unsicherheit kam es vor, dass die Spitex nicht mehr oder nur noch reduziert zu Hausbesuchen kam – zum Teil, weil die Spitex den Schutz nicht aufrecht erhalten konnte, zum Teil wurde sie von Patienten oder Angehörigen aus Vorsicht abbestellt. Das hat dann in den Familien zu mehr Stress und grosser Belastung geführt.
Der Zusammenbruch des fein gewebten und genau ausgeklügelten Systems, das wir für die Betreuung von betagten Menschen haben, hatte verheerende Konsequenzen. Viele, vor allem jene, die alleine leben, waren unterversorgt, zum Teil bis zur Verwahrlosung. Viele, die anderweitig krank waren, haben sich nicht getraut, ins Spital zu gehen – aus Angst vor Ansteckung oder weil sie das System nicht zusätzlich belasten wollten. Zum Ende der ersten Welle füllten sich die Spitäler mit völlig kraftlosen Menschen – Muskelschwund aufgrund von Bewegungsmangel oder Patienten, bei denen die Medikamente längst hätten angepasst werden sollen. Wenn zum Beispiel bei dekompensierten Herzerkrankungen die Medikamente nicht richtig eingestellt sind, staut sich im Körper Wasser an – das führt zu Ödemen und Atemnot.
Was waren für Sie die schwierigsten Momente?
Die erhöhte Ansteckungsgefahr im Spital stellt uns vor grosse Herausforderungen. Die Verantwortung und die Sorge um unsere älteren und daher gefährdeten Patiente ist gross und für das gesamte Personal eine Belastung. Ein Beispiel: Früher konnten wir Menschen nach Eingriffen oder Behandlungen nach Hause schicken und regelmässige Nachkontrollen durch die Spitex oder im Spital organisieren. Jetzt müssen wir uns überlegen, ob man den Genesenden die zusätzlichen Kontakte zumuten kann – sei es mit verschiedenen Mitarbeitenden der Spitex, seien es Kontakte im ÖV auf dem Weg zum Spital, im Taxi, die Sprechstundenhilfe und so weiter – jeder Kontakt muss abgewogen werden.
Auch hier stellt sich die Frage, was wir in Zukunft virtuell machen können, wie man medizinische Beratung per Videocall anbieten kann. In der ersten Welle waren ja viele Hausärztinnen und -ärzte oder spezialisierte Fachärzte in Kurzarbeit. Sie hätte man vielleicht für solche digitalen Konsultationen einsetzen können. In den Spitälern brauchen wir eine bessere Digitalisierung in Bezug auf die Kommunikation mit Patienten und Patientinnen oder mit ihren Angehörigen: Viele Informationen könnte man auch multimedial zur Verfügung stellen.
Mir persönlich fehlt der Austausch mit den Arbeitskollegen. Wir sind immer auf Abstand, mit Masken, man isst alleine… das macht es anstrengend. Gleichzeitig spürt man, dass die gesellschaftliche Anerkennung unserer Arbeit gewachsen ist. Das gibt mir viel Energie zurück. Im Gesundheitssystem sind wir stolz auf unsere Leistungen im vergangenen Jahr.
Wie geht es mit den Impfungen voran?
Ich sehe einen regelrechten Impf-Enthusiasmus, wir haben sehr viele Anfragen. Grundsätzlich sollen ja in der Schweiz zuerst die Hochrisikopatienten geimpft werden – aber das ist schwieriger als angenommen: Viele von ihnen befinden sich aktuell in Spitälern. Da man aber nicht weiss, wie lange sie dort bleiben, ist unklar, wo sie dann die zweite Dosis erhalten sollen. Daher impft man in den Spitälern jetzt prioritär das Personal – welches allerdings in vielen Fällen Vorbehalte bezüglich der Impfung hat. Es fehlt spezifisches Wissen über der Impfstoffe. Es ist nicht so, dass das Personal die Impfung an sich ablehnen würde, aber die Mitarbeitenden brauchen mehr Informationen, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Ich spreche hier genauso vom Pflegepersonal wie von der Ärzteschaft oder den Therapeutinnen und Therapeuten.
In den Pflegeheimen hingegen läuft es sehr gut. In den letzten Wochen wurde ein grosser Aufwand betrieben, um Bewohner und Personal zu impfen. Praktisch alle, die durften, haben sich auch impfen lassen. Das bringt grosse Entspannung – trotz der bisher unveränderten Sicherheitsmassnahmen und Schutzkonzepte nach der Impfung. Die Impfung wird ein Game Changer sein in den nächsten Monaten. Aus Grossbritannien und Israel wissen wir ja, dass schon die erste Dosis das Risiko einer schweren Erkrankung massiv senkt. Unser langfristiges Ziel ist es, dass niemand mehr an Covid-19 sterben muss und die Spitäler nicht überlastet werden.
Haben heute mehr Menschen eine Patientenverfügungen?
Ja. Ich glaube, unsere gesamte Bevölkerung denkt mehr darüber nach, wie wir sterben wollen. Die FMH und andere Institutionen bieten Standardverfügungen an, in denen man die gewünschten Massnahmen ankreuzen kann. Diese Vorlagen werden nun häufig genutzt. Der Nachteil: Sie beziehen sich nicht auf die spezifische Situation einer Person. Daher fragen wir bei jedem Patienten nach: “Wollen Sie im Fall eines Herzstillstandes reanimiert werden?” oder “Möchten Sie an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden?” Wir erklären, was das genau bedeutet und was diese Massnahmen für Konsequenzen mit sich bringen können. Im TV drückt man einem Menschen mit Herzstillstand zweimal auf die Brust und er lebt wieder. In der Realität überlebt ein älterer Mensch eine Herzkreislaufmassage in der Regel nur selten und wenn, dann in einem stark eingeschränkten Zustand, den sich die meisten nicht wünschen.
Was antworten Sie einer Person, die behauptet, dass es sowieso zu viele alte Menschen gäbe?
Am liebsten reagiere ich mit einer Gegenfrage: Wo soll denn die Grenze gezogen werden? Wann ist man alt genug zum Sterben oder zu alt um noch leben zu dürfen? Müssten Menschen mit Behinderung dann auch gehen? Wenn solche Gedanken zu Ende geführt werden, nähert man sich dem Gedankengut des Nationalsozialismus. Unser gesellschaftlicher Vertrag lautet, dass wir das Recht auf Leben aller respektieren, egal um wen es sich handelt. Das Alter ist ein Teil davon. Wir dürfen hoffentlich alle alt werden.
Ich werde auch häufig gefragt, ob meine Arbeit die Angst vor dem Alter vergrössert oder ob es mich nicht davor graust. Im Gegenteil! Ich freue mich zunehmend darauf. Sicher gibt es im Alter schwierige und unschöne Situationen. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die ihr Alter mit Stil und Bravour meistern und geniessen.
.

Über Daniel Andres
Dr. Daniel Andres ist Assistenzarzt für Geriatrie. Sein Medizinstudium schloss er 2019 an der Universität Bern ab. Er wohnt in Bern und ist Vater einer zweijährigen Tochter.

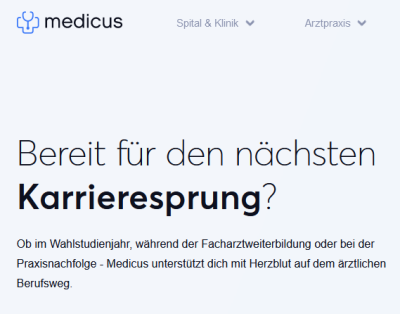

Kommentare
Noch kein Kommentar veröffentlicht.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion