
Jugendliche Mädchen sind am verletzlichsten
Schlaf-, Ess- und Angststörungen: Jugendliche leiden während der Pandemie besonders stark. Schwere Depressionen haben in der Schweiz gar um das Sechsfache zugenommen. Darüber haben wir mit Annina Renk, leitende Ärztin der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Bern, gesprochen.
10.08.2021
Frau Renk, Sie haben kürzlich in einem Interview mit TeleBielingue erwähnt, dass in letzter Zeit doppelt so viele Jugendliche bei Ihnen in die Sprechstunde kommen als vor der Pandemie – und dass die Fälle schwerer werden. Wie entwickelt sich die Lage?
Interessant ist, dass es vielen Menschen – und auch vielen unserer bisherigen Patient:innen – in der ersten Phase der Pandemie besser ging. Ich denke zum Beispiel an Kinder und Jugendliche mit Schulphobie oder Autismus-Spektrumstörungen: Durch das Homeschooling fiel der Druck des Umgangs mit anderen weg und sie konnten sich etwas entspannen. Auch die Entschleunigung tat vielen Menschen gut.
Ab Mai 2020, und vor allem ab Herbst, verschlechterte sich die Lage und es kam zu enorm vielen Anmeldungen. Auffällig sind die Häufigkeit der Krisen- und Notfallgespräche sowie die Dringlichkeit und der Schweregrad der Situationen. Gemäss Swiss Covid Study haben schwere Depressionen bei Jugendlichen schweizweit im zweiten Lockdown um das Sechsfache zugenommen. Ebenfalls gehäuft sind Somatisierungen (Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Erbrechen), Konversionsstörungen – das sind körperliche Störungen, die durch die Psyche ausgelöst werden – und neurologische Auffälligkeiten bei Jugendlichen, wie dass sie zum Beispiel nicht mehr gehen konnten. Bei Jugendlichen traten solche Phänomene vor der Pandemie weniger auf, in letzter Zeit vermehrt.
Inzwischen haben wir zwar nicht mehr ganz so viele Anmeldungen wie im Herbst, aber das Niveau ist noch immer deutlich höher als vor der Pandemie.
Was genau ist denn durch die Pandemie ausgelöst worden?
Mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen. Wir wissen, dass bei Angststörungen in der Regel eine Veranlagung vorliegt, die dann durch Belastung zum Ausbruch kommt. Und natürlich war die Pandemie eine grosse Belastung, gerade für Jugendliche, denen der Kontakt zu Gleichaltrigen genauso fehlte wie der Sport, die Orientierung an der Gruppe, die Freiheit und Unabhängigkeit.
Vor allem bei jungen Menschen, denen es schon vorher nicht gut ging, verschlechterte sich die Situation teilweise dramatisch: bei Jugendlichen ohne Lehrstelle, die in den letzten Monaten nicht mal schnuppern gehen konnten, oder bei anderen, deren Angehörige krank waren oder zur Risikogruppe gehörten. Jugendliche Mädchen waren schon davor besonders betroffen von psychischen Krankheiten – das zieht sich auch durch diese Pandemie. Sie sind die vulnerabelste Gruppe unserer Gesellschaft.
Auch unauffällige, sonst gesunde Kindern können Ängste entwickeln – dass sie selbst oder jemand aus der Familie an Covid erkranken oder sogar sterben könnten. So bekam zum Beispiel ein kleiner fussballbegeisterte Junge, der sonst unauffällig war, plötzlich Angst zu ersticken oder einen Herzstillstand zu erleben – wie er es bei Fussballspielern im Fernsehen gesehen hatte. Möglicherweise hätte dieser Junge das vielleicht selbst verarbeiten können – durch die Pandemie-Belastung sind er und sein Umfeld verunsichert und er braucht Unterstützung.
Was macht die Situation mit Ihnen und Ihrem Team? Die Pandemie hat auch Sie vor erschwerte Bedingungen gestellt.
Die Vielzahl der Anfragen und der dringenden Situationen sind eine Herausforderung. Wir müssen Prioritäten setzen und die dringendsten und schwersten Fälle rasch behandeln. Was ist am dringendsten? Das ist manchmal schwierig zu beurteilen, wenn sich verzweifelte Eltern melden. Einiges musste zurückstehen, beispielsweise auf ADHS- oder Autismus-Abklärungen müssen zum Teil bis zu einem Jahr darauf warten. Dementsprechend sind gewisse Menschen unzufrieden, was für unser Sekretariat nicht immer einfach ist, die meisten Leute zeigen jedoch Verständnis.
Wir haben nicht genügend Ressourcen. Die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) konnte auf Wunsch des Kantons das Angebot ausweiten und eine ambulante Krisenintervention (AKI) anbieten. Für zwei Jahren haben wir zusätzliche Teams aus Ärzt:innen, Psycholog:innen, Pflegefachkräften und Pädagog:innen, die intensiv mit den Kindern und Jugendlichen und deren Familien arbeiten. Seit Mai können wir bis zu 4 Termine pro Woche anbieten, teils in unserem regionalen Kompetenzzentrum, teils auch aufsuchend. Das Angebot ist auf 12 Wochen limitiert und dient dazu, die Situation zu stabilisieren und die Wartezeit für eine ambulante oder stationäre Behandlung zu überbrücken. Auch in der Klinik sind alle Betten besetzt und, in unserem Notfallzentrum in Bern teilweise zu 200%. Wir haben sehr viele Anfragen und die Agenden sind gefüllt. Das Team AKI in Biel ist allerdings noch nicht komplett.
Auch bei Kinderärzt:innen und an anderen Stellen ist es schwierig einen Termin zu bekommen und die Familien werden manchmal an uns verwiesen.
Wie können Angehörige betroffenen jungen Menschen helfen?
Präventiv ist es zentral, eine gesunde Lebenshygiene zu vermitteln. Dazu gehören genügend Schlaf, regelmässige Mahlzeiten, Sport, kein Substanzkonsum, Kontakte zu Freunden und vor allem Wertschätzung. Wertschätzung ist wichtig, uns Menschen geht es besser, wenn wir positive Erlebnisse haben. Angehörige können im Alltag dafür sorgen. Dabei geht es oft auch um die kleinen Dinge: gemeinsam ein Spiel spielen, im Wald spazieren, sich Zeit nehmen und zusammen einen Film anschauen. Kinder und Jugendliche möchten wahrgenommen und gelobt werden.
Was würden Sie in der nächsten Pandemie anders machen?
Die nächste Pandemie würde reibungsloser ablaufen, weil wir alle viele Erfahrungen gesammelt haben. Die ganzen digitalen Lösungen haben sich ja gut eingespielt. Am Anfang hatten wir Mühe, aber jetzt läuft es gut und hat sogar in vielen Fällen Vorteile. Auch beim Homeschooling weiss man schon deutlich besser, was gut funktioniert und was Schüler:innen brauchen. Wir könnten auch wieder Gruppentherapien und Elterngruppen anbieten, was bisher nicht möglich war und es wäre sicherlich hilfreich. Und sicher das neue Angebot der ambulanten Krisenintervention: Die Kinder und Jugendliche und ihre Familien intensiv und aufsuchend behandeln.

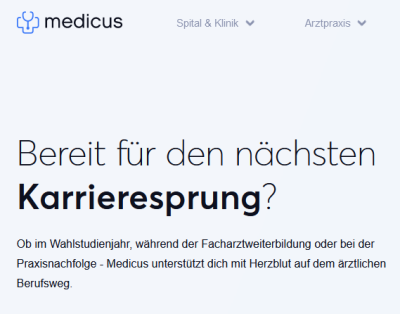

Kommentare
Noch kein Kommentar veröffentlicht.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion