
Die Behandlung von Coronapatienten ist der neue Normalfall
Interview mit einem plastischen Chirurgen, der während der Pandemie auf der Intensivstation einer Uniklinik eingeteilt ist. Aus der VSAO-Reihe #Ärtzealltag.
30.04.2020
“Bei einem plastischen Chirurgen gehen die meisten Menschen davon aus, dass er mehrheitlich Schönheitsoperationen durchführt und kaum Patienten mit hohem Leidensdruck behandelt. Bei uns im Unispital ist das sehr wohl der Fall. Wir betreuen zum Beispiel viele Patienten mit Tumoren, Verbrennungen, chronischen Wunden oder Schmerzen wie beim Karpaltunnelsyndrom. Auch Frauen, die nach Brustkrebs auf eine Brustrekonstruktion warten, haben oft einen hohen Leidensdruck. Da aber die meisten unserer Eingriffe nicht dringlich sind, wurden sie in den letzten Wochen wegen Corona nicht durchgeführt und wir hatten plötzlich freie Kapazitäten. Ausserdem rotieren wir Chirurgen in der Ausbildung durch verschiedene Stationen und kennen die Arbeit auf der Intensivstation – unter normalen Umständen betreuen wir dort zum Beispiel Menschen mit Verbrennungen. Daher konnten wir nun unkompliziert auf die Intensivstation versetzt werden, um auszuhelfen. Das Spital, in dem ich arbeite, hat normalerweise fünf Intensivstationen mit insgesamt rund 35 Betten. Es wurden unter anderem in den Operationssälen sechs weitere Intensivstationen eingerichtet. Für den Worst Case haben wir insgesamt 85 Beatmungsplätze zur Verfügung. Die Intensivstationen, auf denen die Corona-Patienten untergebracht sind, werden von den Intensivmedizinern und Anästhesisten geleitet, die regulären bekamen Unterstützung aus anderen Fachbereichen.
Die Arbeit während der letzten Wochen war emotional und intellektuell herausfordernd – nicht, weil wir mehr gearbeitet hätten, sondern vor allem, weil wir permanent mit neuen Situationen konfrontiert waren und viel Neues in kurzer Zeit lernen mussten. Auf der Intensivstation hatte ich es zum Beispiel viel mehr mit Kardiofällen zu tun und musste mich in einige Arbeitsabläufe wieder einarbeiten und vieles neu dazulernen. Wie man zum Beispiel den Blutdruck einstellt, gehört normalerweise nicht zu unserem Aufgabengebiet – hier konnten wir mit der Unterstützung der Fachärzte schnell dazulernen und diese bald entlasten. Auch hatten wir in dieser Zeit viel häufiger mit Entscheidungen über Leben und Tod zu tun. Soll man mit einer Behandlung noch weiterfahren oder nicht? Das sind Momente, die sehr belastend sein können. Umso dankbarer waren wir alle, dass wir nie an die Grenzen der Belastbarkeit gekommen sind, sondern immer genügend Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung standen, damit auch Entspannung und Freizeit möglich waren. Das Tolle: Die Ärzteschaft hat über alle Fachbereiche hinweg ausgesprochen konstruktiv zusammengearbeitet. Es war spürbar, dass es allen darum geht, jederzeit das Beste für die Patienten möglich zu machen. Die Krise hat unseren “Esprit de Corps” gestärkt, die Solidarität hat zugenommen. Das beschreiben übrigens auch die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern.
Neben der Arbeit auf der Intensivstation haben wir natürlich unsere bisherigen Patienten weiter betreut – und neue Formen dafür gefunden. Gerade bei älteren Patienten war es nicht möglich, sie zur Sprechstunde zu bitten. Ein 82-jähriger Herr mit einer chronischen Wunde am Knöchel kam vor Corona einmal zu mir in die Sprechstunde. Normalerweise hätten wir in der Folge wöchentliche Termine mit der Wundexpertin gemacht, was dann leider nicht möglich war. Die Wundexpertin hat für diesen Patienten Betreuung durch die Spitex organisiert und wir haben mit der Spitex-Mitarbeiterin per E-Mail zusammen an dieser Wunde gearbeitet. Sie hat uns regelmässig Fotos geschickt und wir haben sie auf diese Weise beraten. Dass diese Form von Zusammenarbeit möglich ist, liegt auch daran, dass unser Spital vor einem halben Jahr Smartphones für die Ärzte eingeführt hat, über die wir kommunizieren können. Dort haben wir eine Foto-App, über die Bilder verschlüsselt hochgeladen werden können. Das war ein Glücksfall für diese Zeit, in der die Telemedizin einen ungeahnten Aufschwung bekam. Mit der Ärztin oder dem Arzt zwischendurch Fragen einfach telefonisch zu klären ist für ältere Patienten eine Entlastung – viele hätten das wohl vor Corona noch nicht akzeptiert, aber es wurde sehr gut angenommen. Trotzdem bin ich froh, wenn wir die Menschen in Zukunft hoffentlich wieder öfter persönlich sehen können, denn der menschliche Kontakt ist einfach ein wichtiges Element unserer Arbeit.
Noch bis Mai bleibe ich auf der Intensivstation in der Romandie. Meine nächste Rotation ins Wallis wurde um 2 Monate verschoben. Hier hätte ich mir vom Spital eine transparentere Kommunikation gewünscht, aber es muss wohl noch immer abgewartet werden, welche Konsequenzen die Lockerungen der Corona-Einschränkungen haben werden. Noch liegt keine offizielle Weisung vor, wann wir wieder normal operieren können. Der Platz wäre jetzt wieder vorhanden und man könnte damit beginnen, einen Teil der Notfall-Infrastruktur herunterzufahren, aber die Sorge vor einer neuen Welle ist präsent und man möchte nichts überstürzen. Ausserdem sind die Anästhesisten weiterhin mit den Corona-Fällen beschäftigt und stehen uns nicht zur Verfügung. Den Normalfall wird es im Spital in den nächsten Monaten und vielleicht sogar bis ins nächste Jahr nicht geben. Die Behandlung und Isolation von Corona-Patienten wird bis auf Weiteres der neue Normalfall sein. Was genau das bedeutet, muss sich erst noch zeigen. Ein Ansteigen der Kurve ist jederzeit wieder möglich.
Deshalb implementiert die Spitalleitung nun neue Massnahmen – dass man zum Beispiel auch in Zukunft bei Risikogruppen mehr auf telefonische Betreuung setzt, dass dauerhaft weniger Menschen in einem Wartezimmer sein dürfen oder dass für mehr Distanz in den Behandlungsräumen gesorgt wird.
Alle anderen anstehenden Operationen müssen wir neue bewerten und die Patienten gestaffelt aufbieten. Wer kann warten, was ist dringend? Hier müssen wir – wie immer – Prioritäten setzen. Nur werden die Wartezeiten voraussichtlich länger. Bisher lagen sie bei zwei bis vier Monaten, dieses Jahr werden Patienten mit nicht dringlichen Operationen wohl ein halbes bis Dreivierteljahr warten müssen.

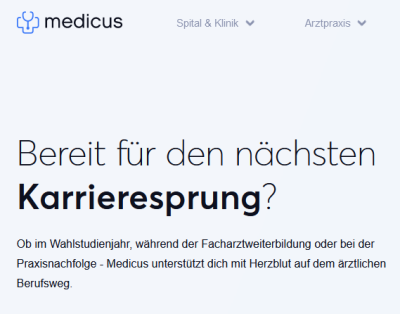

Kommentare
Noch kein Kommentar veröffentlicht.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion