
Krisen treffen auch Ärzt:innen
ReMed berät und begleitet Ärztinnen und Ärzte, die vor oder in einer Krise stehen. Dr. Sabine Werner und Dr. Peter Christen sind Teil des Teams und begleiten Ratsuchende dabei, neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, um Konflikte zu lösen, Wege aus der Überlastung zu finden oder an anderer Stelle Hilfe zu erhalten. Ihr Angebot ist immens wichtig, denn immer mehr Mediziner:innen stehen unter enormen Druck. So ist die Selbstmordraten unter Ärzten im Vergleich zur Gesamtbevölkerung dreimal höher, unter Ärztinnen sogar sechsmal.
25.11.2021
Liebe Sabine, lieber Peter, ihr seid im Leitungsteam von ReMed. Wie war euer Werdegang?
Dr. Sabine Werner: Nach 14 sehr arbeitsreichen Jahren als Dermatologin in eigener Praxis in St. Moritz wollte ich gerne wieder in einem Team arbeiten, verschiedene Interessen miteinander verbinden und ein Stück Erfahrung vor allem auch an jüngere Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Über eine Coaching-Ausbildung bin ich zu ReMed gekommen und wurde dann angefragt, ob ich mitarbeiten möchte. Vor ein paar Jahren habe ich meine Praxis verkauft und arbeite jetzt Teilzeit in einem medizinischen Zentrum. Es ist mir ein grosses Anliegen, Ärztinnen und Ärzte als Kollegin so zu unterstützen, wie ich es selbst damals als junge Ärztin vermisst habe. Und Menschen dabei zu ermutigen und zu befähigen, die eigene Berufslaufbahn so zu gestalten, wie es einem gut tut und man es sich wünscht, um mit Freude und Erfolg in persönlicher Balance tätig zu sein.
Dr. Peter Christen: Ich habe während 28 Jahren als Hausarzt und Mitinhaber in einer Quartier Gemeinschaftspraxis in Zürich gearbeitet. Mit nun 66 Jahren bin ich seit einem Jahr in Teil-Pensionierung. Für einen ganzheitlicheren Zugang habe ich vor 20 Jahren den Fähigkeitsausweis in Psychosomatik/Psychosoziale Medizin erworben und eine Masterausbildung in Systemischer Psychotherapie angehängt. Dieses Verlagern meiner Schwerpunkte war allerdings nur Dank der Unterstützung meiner Familie und meiner Praxiskolleg:innen möglich! Jetzt arbeite ich mit viel Freude in einem Teilpensum als Psychotherapeut in unserer Praxis. Seit sieben Jahren bin ich Programmleiter bei ReMed und als Beratender und Mitkoordinator des Programms tätig. Ich empfinde es als ein Privileg, mit meiner Erfahrung Kolleg:innen in beruflichen Krisen zu unterstützen und gemeinsam Lösungen für ein glückliches Arbeiten und eine befriedigende Work-Life-Balance zu entwickeln.
Für Kolleg:innen, die noch nie etwas von ReMed gehört haben. Was bietet ihr ausser Krisenberatungen für Ärzt:innen noch an?
Peter: Unser zweites Standbein ist die Prävention. Wie können wir Ärzt:innen unterstützen, dass sie nicht erst fünf-nach-zwölf Unterstützung suchen? Wir zeigen anhand von Testimonials, konkrete Fälle auf und machen unter anderem auch in der Ärztezeitung auf die häufigsten Beratungsthemen aufmerksam. Ausserdem gehen wir in Spitäler und Kliniken oder an Kongresse und leisten dort Präventionsarbeit in Weiterbildungen, beispielsweise mit Hilfe von interaktiven Rollenspielen oder einem Forumtheater.
Was kann ich mir unter einem Forumtheater vorstellen?
Peter: Das Forumtheater mit zwei bis drei Profischauspieler:innen bezieht das Publikum mit Hilfe einer Moderatorin in gespielte Szenen ein. Die Schauspieler:innen spielen eine Szene an – zum Beispiel einen typischen Konflikt zwischen Chefarzt und Assistenzarzt. Die Moderatorin unterbricht eine Szene und nimmt Kontakt mit dem Publikum auf. Sie fragt, wie sich der jüngere Kollege in dieser Situation verhalten könnte und nimmt Ideen aus dem Publikum auf. Die Szene wird neu gespielt. So kann das Publikum Einfluss auf den Verlauf nehmen und live erleben, welche Veränderungen möglich sind. Auf diese Art sensibilisieren wir niederschwellig für problematische Situationen und thematisieren Tabus. Aktuell arbeiten wir mit einem Forumtheater in der Deutschschweiz und eines in der Romandie.
Sind denn die Spitäler offen für solche Projekte?
Sabine: Das ist die Crux: Offene, dynamische Spitäler laden uns ein und wir sind willkommen. Bei anderen beissen wir auf Granit. Manchmal billigt man uns 15 Min im Morgenrapport zu – um 7:30 Uhr. In anderen Fällen erhalten wir anderthalb Stunden in der Weiterbildung, an der dann alle teilnehmen können. Wir bleiben dran und versuchen, alle Spitäler mit diesen Themen zu erreichen.
Wie schnell erhalten Ratsuchende von euch Hilfe und wer übernimmt die Kosten?
Peter: Nach einer Kontaktaufnahme nehmen wir garantiert innerhalb von 72 Stunden mit der Person Kontakt auf. Die ersten zwei Stunden der Beratung bezahlt die FMH. In dieser Zeit findet das Erstgespräch statt, in dem wir eine Auslegeordnung vornehmen und die nächsten Schritte besprechen. Später gibt es Follow-ups per Mail oder Telefon um zu sehen, was sich entwickelt hat und ob zusätzliche Massnahmen nötig sind. Wenn ja, dann vermitteln wir die Betroffenen an Fachpersonen und stellen sicher, dass der Kontakt wirklich zustande kommt.
In zwei Forschungsarbeiten über unsere Arbeit stellte sich die erfolgreiche Weiterweisung als Schlüsselthema heraus, denn wenn wir hier nicht unterstützen, passiert oft nichts. Beispielsweise sind nachbehandelnde Psychiater:innen überlastet und oft ist es schwierig, einen Termin zu bekommen. Möglicherweise hat der oder die Anrufende aufgrund einer Depression nicht die Kraft, selbst Kontakt aufzunehmen, haben plötzlich Zweifel, ob sie nun wirklich den nächsten Schritt gehen sollen oder nicht. Wir motivieren, dass sie eine Veränderung einleiten können. Je nach Fall leiten wir an eine Juristin oder einen Mediator, einen Coach oder eine Beratungsstelle weiter. Die Folgekosten werden in der weiteren Arzt-Patienten-Beziehung getragen oder in der direkten Bezahlung der Fachperson.
Sabine: Wir sind In der ganzen Schweiz dreisprachig vernetzt mit rund 35 bewährten Netzwerkpartner:innen. Im Idealfall können wir regional vermitteln. Wenn es um Rechtsberatung geht, verweisen wir zum Beispiel gerne an den VSAO. Bei Laufbahnthemen kann unsere Schwesterorganisation Coach My Career, die auch bei der FMH angesiedelt ist, weitere Unterstützung bieten. Manchmal besprechen wir bereits in der Erstberatung Laufbahnthemen oder vermitteln auf Wunsch einen Coach aus unserem Netzwerk.
Üblicherweise hören Ärzt:innen ihren Patient:innen zu. Besteht eine grosse Nachfrage von Ärzt:innen nach jemandem, der ihnen zuhört?
Sabine: Die Hürde, Kontakt aufzunehmen und sich Hilfe zu holen, ist für viele sehr hoch. Wenn sie aber erst einmal überwunden ist, ist es für viele Ärzt:innen eine sehr grosse Entlastung, dass ihnen jemand zuhört und ihr Problem auf Augenhöhe verstehen kann. Unser offenes Ohr wird dann gerne angenommen und die Hilfesuchenden sind ausgesprochen dankbar. Das macht es für uns so sinnstiftend.
In wie vielen Fällen reichen zwei Stunden Beratung aus und wie häufig verweist ihr an Spezialist:innen?
Peter: Wir führen dazu keine Statistik, aber erfahrungsgemäss reichen in 60 Prozent der Fälle zwei Stunden Beratung. Etwa 40 Prozent der Betroffenen weisen wir weiter.
Zu welchen Themen suchen Ärzt:innen bei euch Hilfe?
Peter: Etwa ein Drittel der Fälle dreht sich um die Work-Life-Balance, also um die Doppelrolle und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Privatleben. Betroffen sind öfter Frauen, aber durchaus auch viele Männer. Viele Fälle drehen sich um strukturelle Themen in der Klinik – wie arbeitsrechtliche Themen oder Probleme mit Vorgesetzten und Kolleg:innen oder mit dem Curriculum. Viele fühlen sich nicht wohl am Arbeitsort oder stellen sich die Frage, ob sie die Anforderungen bewältigen können. Auch nicht zu unterschätzen sind die somatischen Krankheiten und längere Arbeitsausfälle. Ärzt:innen, die beispielsweise aufgrund einer Chemo arbeitsunfähig sind und sich fragen: “Wie organisiere ich meine Praxis?” Oder die sich aufgrund einer MS neu orientieren müssen. Auch Kolleg:innen mit solchen Themen wenden sich an uns.
Sabine: Ärztinnen mit Gefühlen von Insuffizienz kontaktieren uns wirklich sehr häufig. Sie denken, nur sie seien überlastet. Es entsteht der Eindruck: “Alle anderen ausser mir können das!” Viele haben grosse Selbstzweifel und stellen in Frage, ob der Beruf der richtige für sie ist.
Peter: Wir haben hier eine toxische Situation. Ärzt:innen in Spitäler sind einerseits Arbeitnehmer, andererseits in Weiterbildung. Arbeitsrechtliche Wege werden nicht beschritten. Man kann sich nicht ans HR oder Vorgesetzte wenden, weil die Abhängigkeit so unglaublich gross ist. Es wird nicht reklamiert, weil man es schlicht nicht wagt. Viele haben Angst vor beruflichen Nachteilen und einem Karriereknick. Für diese Situation gibt es keine schlüssige Lösung, weil man tatsächlich mit Nachteilen rechnen muss, wenn man Überlastung zugibt.
Sabine: Wir Ärztinnen und Ärzte leben und pflegen einen Heldenmythos. Wir klopfen uns auf die Schulter, dass wir so viele Stunden arbeiten, zwischendurch nichts essen und so weiter. Ein erster Schritt wäre zuzugeben, dass wir nicht immer 150 Prozent geben können!
Peter: Ein weiterer zentraler Grund, diese Situation zu verändern, ist die Behandlungssicherheit. Es kommt immer wieder zu Situationen, in denen übermüdete Operateure nach acht Stunden regulärem Dienst auch noch die Nachtschicht übernehmen und weitere acht Stunden im OP stehen. Bei Lokführern oder Lastwagenfahrern wäre das unmöglich – bei Ärzt:innen ist das normal! Oder Ärzt:innen die stolz erzählen, dass sie mit Magen-Darm-Grippe eine Patientin wiederbelebt haben.
Uns fehlt eine Kultur der Standortbestimmung. Immer wieder sprechen wir mit Assistenzärzt:innen, bei denen das Standortgespräch zwei Tage vor dem Ende der Anstellung stattgefunden hat. Da sind wir jetzt auch standespolitisch aktiv. Wir verlangen mit Nachdruck, dass, wie in anderen Berufen, Mentor:innen ihre Aufgabe wahrnehmen und regelmässige Standortbestimmungen sicherstellen. Und nicht nur das: Uns fehlt auch eine Fehlerkultur und eine Kultur der offenen Kommunikation.
Gerade von Assistenzärzt:innen erwartet man immer noch eine starke Arbeitsbelastung, zeitlich wie emotional. Was raten Sie Kolleg:innen zur Prävention gegen Überlastung?
Sabine: Entscheidend ist, sich frühzeitig um eine gesunde Selbstfürsorge zu kümmern. Wir lernen anderen zu helfen und vergessen dabei, dass wir selbst gesund sein müssen, um gute Ärzt:innen zu sein. Ich vergleiche es gerne mit einer Notfall-Situation im Flugzeug – sich selbst setzt man zuerst die Sauerstoffmaske auf, damit man anderen helfen kann. Damit man langfristig gesund und glücklich ist, braucht man eine gute Achtsamkeit sich selbst gegenüber: Wie geht es mir? Wann sind meine Grenzen erreicht oder überschritten? Wie sehen meine persönlichen Alarmzeichen aus? Ich zum Beispiel muss hellhörig werden, wenn ich mich nach den Ferien nicht erholt fühle. Weitere wichtige Fragen sind: Was gibt mir Energie, was raubt mir Energie? Was kann ich delegieren? Es geht dabei darum, sich frühzeitig eine Strategie zuzulegen, um den Akku wieder aufzufüllen und lernen, sich besser abzugrenzen. Schlussendlich geht es um Selbstmanagement-Fähigkeiten und um die eigenen Haltung: Welches Bild habe ich von einem guten Arzt und einer guten Ärztin? Wie leistungsfähig muss ich in meiner Vorstellung sein? Darf ich auch mal müde und schwach sein? In der Phase der Weiterbildung ist man so sehr mit dem Aufbau der fachlichen Kompetenz beschäftigt, dass man diese Dinge ausser acht lässt oder gar nie lernt.
Peter: Ergänzend dazu müssen wir unbedingt einen Blick auf die Arbeitskultur einer Abteilung oder eines Spitals werfen. Allein ist es oft nicht möglich, diese Kultur zu verändern. Hier geht es darum, andere mit ins Boot zu holen – Gleichgestellte, aber auch Oberärzt:innen mit Verständnis für diese Themen. Wir müssen Allianzen bilden und erfahrene Vorgesetzte bitten, uns als Mentor:innen zur Seite zu stehen. Es geht darum, sowohl die Arbeit wie auch die Fehlerkultur zu verändern. Und zwar so, dass auch in hierarchischen Strukturen kleine Schritte der Veränderungen möglich sind. Ratsuchende Kolleg:innen sind oft positiv überrascht, dass es sich wirklich lohnt, mutig zu sein. Und zusammen ist man einfach viel stärker als jeder einzelne für sich.
Sind viele Ärzt:innen von Krisen betroffen?
Sabine: Eine Metastudie zur Suizidalität unter Ärztinnen und Ärzten* kam zu dem erschreckenden Ergebnis, dass die Selbstmordraten unter Ärzten im Vergleich zur Gesamtbevölkerung dreimal häufiger sind, unter Ärztinnen sogar sechsmal häufiger. Depressive Symptome bzw. Anzeichen eines Burnouts finden sich gemäss verschiedener Studien bei Ärzt:innen sogar bei ca. 50 Prozent im Vergleich zu 25 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und fast 30 Prozent der Schweizer Assistenzärzt:innen geben an, während der Assistenzzeit unter emotionaler Erschöpfung oder Dauerstress gelitten zu haben**. Hier ist also dringender Handlungsbedarf angesagt!
Können wir uns zu wenig schützen oder sind wir es nicht gewöhnt, um Hilfe zu bitten?
Sabine: Beides. Oft steht das eigene Rollenverständnis im Weg: “Ich bin die Heilerin, der Heiler – die Kranken sind die anderen.” Besonders in den ersten Jahren zeigen viele Mediziner:innen ein Over-Commitment und neigen zur Verausgabung. In diesem Helfermodus nimmt man oft gar nicht wahr, dass man selbst Hilfe brauchen würde. Wir sind es einfach nicht gewöhnt, selbst in der Patientenrolle zu sein. Ärzt:innen haben hohe Ideale und viel Durchhaltewillen. Das wurde durch das Studium jahrelang trainiert. Dazu sind die meisten in der Anfangszeit sehr begeistert – das macht es schwierig, das richtige Mass zu finden zwischen dem eigenen Einsatz und dem, was man an Gratifikation zurückbekommt. Ausserdem ist die Anerkennung der Gesellschaft auch nicht mehr so wie früher: Statt Halbgöttern in Weiss sind wir heute Kostentreiber, schwarze Schafe oder Abzocker. Die Ansprüche der Menschen sind höher und auch aufgrund von Informationen aus dem Internet stellen sie unsere Expertise eher in Frage.
Peter: Sich selbst zu schützen haben wir weder im Studium noch in der Zeit als Assisten:innen gelernt. Und oft sind es dann unerwartete Situationen, die einen aus der Bahn werfen – man begeht einen schweren Fehler und wird von Angehörigen beschuldigt oder die eigene Mutter bekommt Krebs. Und meist ist es so: Solange man sich nicht kränker fühlt als die Patient:innen, macht man weiter.
Sie beraten auch bei berufsbezogenen Gesundheitsrisiken. Sind Ärzt:innen von bestimmten Krankheiten besonders betroffen?
Peter: Das wird gemutmasst, ist aber nicht gut wissenschaftlich belegt, weil die Mediziner:innen oft zur Selbstmedikation greifen. Bei Suchterkrankungen und psychischen Erkrankungen gibt es eine sehr hohe Dunkelziffer. Davon sind beispielsweise Anästhesist:innen stark betroffen– weil man sozusagen “an der Quelle” sitzt – aber nicht nur sie. Deshalb werden Suchtprobleme meist nicht erfasst und nicht dokumentiert. Dazu kommt: Unserer Erfahrung nach haben 70-80 Prozent der Ärzt:innen keinen Hausarzt. Dabei müsste doch gelten: Damit ich eine gute Ärztin oder ein guter Arzt sein kann, darf und sollte ich auch einmal Patient:in sein. Das gelingt vielen von uns nicht. Besonders gefährlich daran ist auch, dass durch die Selbstmedikation die Behandlung von psychischen Beschwerden immer länger hinausgezögert wird und Burnout oder Suizidalität dadurch fast unausweichlich sind. Menschen in nichtmedizinischen Berufen holen sich früher Hilfe.
Sabine: Julika Zwack bespricht in ihrem Buch “Wie Ärzte gesund bleiben - Resilienz statt Burnout“ was diejenigen Ärztinnen und Ärzte anders machen, die kein Burnout bekommen. Neben Achtsamkeit und gutem Selbstmanagement steht hier die Pflege sozialer Kontakte auch ausserhalb des beruflichen Umfeldes ganz oben in der Wichtigkeit. Das braucht Zeit – aber genau darum geht es. Wir brauchen Phasen der Regeneration, damit wir zu anderen Zeiten Hochleistung bringen können. Medizin ist kein Nine-to-Five-Job – umsomehr müssen wir uns Erholung zubilligen.
Peter: Ja, alte Freundschaften zu pflegen, die nichts mit dem Beruf zu tun haben, ist zentral. Im Sportverein, im Orchester oder mit den Freund:innen aus dem Gymnasium. Menschen, die man wahrscheinlich während des Studiums vernachlässigt hat und die einen wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Damit man eingemittet bleibt und nicht mit Seinesgleichen den Ausnahmezustand glorifiziert. Solche Freund:innen sind ein wichtiges Korrektiv.
Gibt es einfache Tipps zur Psychohygiene?
Peter: Aktives Zeitmanagement ist der Schlüssel – Arbeitszeiten und Auszeiten strikt voneinander trennen. Wenn man jeden Abend zuhause noch Berichte schreibt, ist das kaum sinnvoll.
Sabine: Überhaupt Pausen machen ist entscheidend! Man sollte sich die Pause wirklich einplanen, sich den Wecker stellen. Es gibt ja auch viele Apps, die dabei helfen. Und wenn es nur 5 Minuten sind, in denen ich wirklich bewusst und mit Genuss Kaffee trinke, ohne irgendetwas anderes zu machen. Hilfreich ist auch, sich ein Limit am Ende des Arbeitstags zu setzen, zum Beispiel dass eine Assistenzärztin mindestens einmal pro Woche um 18 Uhr das Spital verlässt. Man kann Arbeit immer ausdehnen, es gibt immer etwas zu tun. Aber man kann es auch umgekehrt machen: Um 18 Uhr muss zumindest das Allerwichtigste erledigt sein und heute kann ich dann raus.
Peter: Gerade bei den Berichten sollte man unbedingt das Pareto-Prinzip anwenden: 80 Prozent perfekt reicht. Die restlichen 20 Prozent Perfektion würden unverhältnismässig viel Zeit kosten für einen überschaubaren Mehrwert. Wir müssen Zeitmanagementsysteme einsetzen! In der Wirtschaft ist das Standard, viele Mediziner:innen kennen das überhaupt nicht.
Durch den Beruf als Arzt oder Ärztin wird man mit vielen Schicksalen konfrontiert. Wie sieht ein ‘’gesunder’’ Umgang mit emotionaler Belastung aus?
Peter: Hier gilt: Reden, reden, reden. Es gibt viele gute Gefässe dafür: Balint-Gruppen zum Beispiel oder Supervision mit erfahrenen Leitenden oder Intervisionen, einmal in der Woche auf der Abteilung eine Nicht-Journal-Zusammenkunft, in der freie Themen besprochen werden und so weiter. Das hilft sehr.
Sabine: Auch hilfreich ist die genaue Unterscheidung: “Was liegt in meiner Macht und in meiner Verantwortung und was nicht?”. Gerade am Anfang des Berufes fällt es uns schwer, dass wir trotz moderner Medizin und Best Practice nicht alles in der Hand haben. Oft verzweifeln wir an Dingen, die gar nicht in unserem Handlungsspielraum liegen. Wenn man tatsächlich einen Fehler gemacht hat, dann sollte man darüber sprechen, um daraus für die Zukunft zu lernen – nicht, um sich endlos zu grämen. Aber auch anerkennen: Wenn ein Patient sich nicht an unsere Empfehlungen hält und es ihm deshalb schlechter geht, dann liegt die Verantwortung beim Patienten. Man sollte sich dem zuwenden, was man beeinflussen kann und abgrenzen, was nicht im eigenen Gestaltungsbereich liegt. Auch im Spital kann man nicht alles verändern, was vielleicht nötig wäre.
Peter: Diese Abgrenzung ist auch eine Frage der Erfahrung. Junge Ärzt:innen denken oft, jeder schlechte Verlauf liege an ihrer Unerfahrenheit. Deshalb ist es wichtig, das Gespräch mit Älteren zu suchen, die einem bei der Unterscheidung helfen. In der Psychiatrie sind Supervisionen eine Selbstverständlichkeit. Das würde allen Ärzt:innen gut tun! Immerhin sind nun bei Niedergelassenen die Qualitätszirkel die Regel. Dort ist CIRS ein fester Bestandteil. Man spricht über Fehler (die oft gar keine sind) und über kritische Ereignisse: Wo liegt das Problem? Ist es ein Fehler? Was können wir das nächste Mal anders machen, Abläufe verbessern. Das ist zentral für die Psychohygiene.
Sabine: Selbst wenn das in der eigenen Abteilung nicht möglich ist – vielleicht kann man eine “Micro-Bubble” bilden und regelmässig mit zwei-drei gleichgesinnten Kolleg:innen aus anderen Abteilungen sprechen.
Woran erkenne ich eine Überlastungssituation?
Peter: Überlastungssituationen erkennt man an psychosomatischen Beschwerden: Schlafstörungen, Konzentrationsmangel, Aufmerksamkeitseinbrüche, Sekundenschlaf im OP, inadäquates Verhalten, nicht mehr mitfühlende Beziehung zu den Patienten – das sind Burnout-Symptome. Wenn diese Zeichen auftreten, stehen die Lampen auf Gelb bis Rot.
Sabine: Häufig ist auch die Depersonalisation, also das Gefühl “So kenne ich mich gar nicht. Ich habe doch früher Freude daran gehabt, jetzt empfinde ich keine Freude mehr.” oder das Gefühl, sich nicht mehr zu erholen.
‘’In meinem Team herrscht ein rauer Umgangston. Burnouts, Depressionen und andere Krankheiten werden von oben herab belächelt. Mir geht es nicht gut.’’ Was kann ich tun?
Sabine: Das Eingeständnis “Mir geht es nicht gut” ist schon sehr, sehr wichtig. Das ist der erste grosse Schritt. Der zweite ist dann, darüber mit vertrauensvollen Personen zu sprechen. Idealerweise hat man von Anfang an ein gutes Unterstützungsnetzwerk, beruflich und ausserberuflich. Wenn mehrere Kolleginnen und Kollegen in einer Abteilung betroffen sind, dann können sie sich zusammenschliessen und gemeinsam Unterstützung – zum Beispiel beim VSAO - holen.
Peter: Auch hier ist der Hausarzt oder die Hausärztin ganz wichtig! Eine solche Situation verlangt nach professioneller Hilfe, denn es geht ja auch oft um somatische Symptome. Die Schwelle sich Hilfe zu holen, ist bei uns Ärzt:innen sehr hoch.
‘’Während der Arbeit fühle ich mich ständig unter Druck, in meiner Freizeit muss ich immer an die Arbeit denken’’. An wen kann ich mich wenden?
Hier kann jemand nicht mehr abschalten. Wenn ich immer unter Druck bin, dann bin ich entweder fachlich überfordert, weil ich Aufgaben erfüllen soll, die ich noch nicht gelernt habe, oder das Pensum ist zu hoch. Hier kann man sich an uns bei ReMed oder den VSAO wenden. Wenn man am Limit läuft, ist es wichtig zu überlegen, ob man seiner Verantwortung den Patienten gegenüber aktuell gerecht werden kann.
Wann sollte man sich krankschreiben lassen?
Peter: Wenn es einem nicht gut geht – aus welchem Grund auch immer – ist es wichtig, eine Aussenperspektive einzuholen. Die Fachperson entscheidet dann, ob man arbeitsfähig ist. Hier heisst es: Verantwortung abgeben.
Schaffe ich den Wiedereinstieg nach einer längeren Krankschreibung?
Sabine: Nach längerem Ausfall ist professionelle Begleitung beim Wiedereinstieg sehr hilfreich, zum Beispiel ein Coaching oder Psychotherapie, damit man nicht in alte Muster zurückfällt. Sonst schlägt oft die Routine wieder zu. Coaches können helfen, eine neue Strategie zu verankern. Je länger die Krankschreibung, desto mehr Unterstützung braucht es beim Wiedereinstieg.
Wenn man krankgeschrieben war, wird man dann von zukünftigen Arbeitgeber:innen diskriminiert?
Die Frage ist, wie erfährt der neue Arbeitgeber, dass man krank war? Bei Angestellten umfasst das Zeugnis ja die ganze Vertragszeit. Manchmal wird man bei einer Teilzeit-Bewerbung gefragt, warum man denn nicht Vollzeit arbeiten will. Hier stellt sich die Frage, wie man dann antwortet. In der Regel empfehlen wir Ehrlichkeit und oft ist man positiv überrascht, wie wohlwollend das aufgenommen wird. Das ist natürlich abhängig vom Arbeitgeber – der übrigens nicht diskriminieren darf.
_____________________
* Reimer et al., Psychiat Prax 2005; 32: 381-385
** B. Buddeberg-Fischer et al., Dtsch Med Wochenschr 2008;133: 2441–2447, Arbeitsstress, Gesundheit und…
ReMed – für Ärzt:innen in Krisensituationen

ReMed berät und begleitet Ärztinnen und Ärzte, die vor oder in einer Krise stehen. Das kann ein Konflikt am Arbeitsplatz sein, aber auch eine persönliche Überlastungssituation oder Herausforderungen in der Work-Life-Balance. Das Unterstützungsnetzwerk meldet sich innerhalb von 72 Stunden nach der ersten Kontaktaufnahme. Anschliessend begleitet ReMed die Ratsuchenden und entwirft mit Ihnen Handlungsmöglichkeiten. ReMed ist an das ärztliche Berufsgeheimnis gebunden.
Kontakt:
Befinden Sie sich in einer schwierigen Situation und suchen Rat? Kennen Sie einen Arzt oder eine Ärztin in Ihrem Umfeld, der oder die Unterstützung benötigt? Dann melden Sie sich bei ReMed über das Kontaktformular https://remed.fmh.ch/kontakt.html.
Andere Wege zu ReMed sind die 24-Stunden-Hotline unter 0800 073 633 oder per E-Mail über .
Informationen:
Möchten Sie mehr wissen und auch Ihre Kolleg:innen auf ReMed aufmerksam machen? Flyer und Kleinplakate auf Deutsch oder Französisch können Sie kostenlos über anfordern. Zusätzliche Informationen finden Sie auf www.swiss-remed.ch.

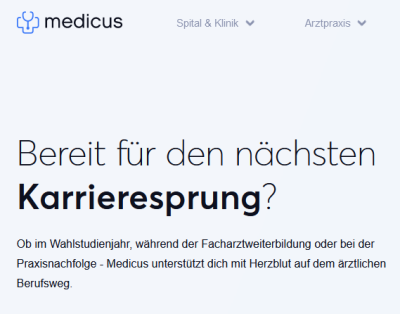
Kommentare
Noch kein Kommentar veröffentlicht.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion