
Interview mit Ruben Bill
Wir interviewten Ruben Bill im Rahmen unserer Kampagne #BerufseinstiegMedizin. Der 35-jährige erzählt uns, weshalb er sich für einen PhD entschieden hat und wie er neben der Familie seine Karriere plant.
01.02.2022
Warum hast du dich für die Medizin entschieden?
Ich habe nicht diesen typischen ‘’Ich will Menschen helfen’’-Zugang zur Medizin, obwohl ich das natürlich auch gut und wichtig finde. Mich faszinieren biologische Prozesse und die damit verbundene wissenschaftliche Auseinandersetzung. Insbesondere gilt mein Interesse der Tumor-Immunologie.
Welchen Facharzttitel hast du während des Studiums angestrebt?
Vor dem Studium war ich offen für diverse Facharztrichtungen. Da ich nicht zufrieden mit meiner Note bei der Maturaarbeit war, dachte ich nicht, dass eine Karriere in der Forschung in Frage käme. Aber dann kam das Laborpraktikum in der Neuroimmunologie in den Sommerferien zwischen dem zweiten und dritten Studienjahr. Das packte mich richtig und ich entwickelte ein besonderes Interesse für dieses Thema. Das, plus meine Affinität für Biologie und die Faszination an Krebserkrankungen, legte Tumorimmunologie als Schwerpunkt für zukünftige Forschung nahe. Entsprechend ist der Facharzt für klinische Onkologie ist die logische Folge.
Deshalb hast du dich für einen PhD entschieden?
Ja, ich denke, das Praktikum auf der Neuroimmunologie am Theodor Kocher Institut in Bern war ein Schlüsselereignis in meiner Karriere. Das internationale Umfeld, der Austausch und auch die gemeinsamen Freizeitaktivitäten haben mich fasziniert. Dort habe ich meine Frau kennengelernt, das hat punkto Motivation sicher auch geholfen. Im vierten Studienjahr konnte ich in Boston zum ersten Mal ausserhalb der Schweiz Forschungsluft schnuppern. Ich komme aus Innertkirchen – die Universität in Harvard mit der international hochrangigen Forschung zu erleben, war für mich höchst eindrucksvoll! Ich will am Puls des aktuellen Wissenserwerbs mitmischen.
Wie hast du deine bisherige Karriere organisiert?
Generell habe ich sehr langfristig geplant. Im Wahlstudienjahr war ich drei Monate auf der Onkologie im Inselspital und habe zu diesem Zeitpunkt schon mündlich eine Assistentenstelle vereinbart. Die Innere Medizin war für meinen Facharzttitel Pflicht. Dafür wollte ich an ein mittelgrosses Spital und deshalb fiel die Entscheidung auf Burgdorf, das hatte ich schon während des vierjährigen PhDs beschlossen. Natürlich gibt es immer irgendwelche Zufälle – zum Beispiel, in welchem Labor man schlussendlich eine Anstellung findet. Die Rückkehr von Boston in die Schweiz wurde möglich, weil mein Vorgesetzter eine Stelle in Lausanne annehmen würde. Für mich war auch immer wichtig, welche Anschlussstellen mir meine Chef:innen empfohlen haben.
Hattest du Vorbilder bei der Planung deiner Karriere?
Ich würde sagen, all meine bisherigen Chef:innen waren für mich Vorbilder, haben mir viel Unterstützung geboten und mich inspiriert. Ein Beispiel: Am Theodor Koch Institut absolvierte ich ein Praktikum und die medizinische Doktorarbeit bei Britta Engelhardt. Sie und ihr Mann haben mir bei der Planung meiner weiteren Forschungsstellen geholfen.
Musstest du dich oft gegen Kommiliton:innen durchsetzen?
Ich hatte nicht den Eindruck, dass für meinen Weg bisher “Ellenbogen” nötig gewesen wären. Für eine Karriere in der Forschung braucht es sicherlich viel Einsatz – aber nicht gegen andere, sondern indem man zeigt, was man wirklich kann und will.
In deinem CV gibt es keine längere Pause. Ist das Zufall oder eine Frage der Einstellung?
Eine Frage der Einstellung. Vor dem PhD sowie letzten Sommer für meinen Umzug in die USA habe ich jeweils einen Monat Pause gemacht – das war’s. Im Nachhinein betrachtet hätten mehr Pausen meiner Karriere nicht geschadet, kurze Lücken im Lebenslauf interessieren niemanden. Ich hatte aber einfach nie das Bedürfnis nach einem längeren Break. Kurz nach dem Studium wurde ich Vater und empfinde seither längere Reisen als anstrengend. Einblick in fremde Kulturen konnte ich immer mit meinen Forschungsaufenthalten im Ausland verbinden. Ein Stück weit lebt man halt auch für die Forschung und möchte, dass die Projekte nicht stehen bleiben.
Was kannst du zum Thema Work-Life-Balance und zu deinen Stellenprozenten sagen?
Bisher habe ich immer 100 Prozent oder eigentlich mehr gearbeitet und hatte nie das Bedürfnis, die Prozente zu reduzieren. Seit dem Staatsexamen hatte ich immer 50- bis 70-Stunden-Wochen, obwohl ich noch nie parallel zur Klinik forschte oder umgekehrt. Nächstes Jahr werde ich einen Tag pro Woche klinisch arbeiten und an den übrigen Tagen forschen. Wahrscheinlich wird das stressiger, da man in der Tendenz allem ein bisschen hinterherhinkt.
Das klingt nach einem sehr intensiven Berufsleben. Ist das auch gesund?
Als ich klinisch arbeitete, waren die Ferien für mich extrem wichtig. In der Klink wird das Tempo von den Patient:innen, den Pflegenden und dem Stationsablauf vorgegeben. In der Onkologie bringt das Fach viele Emotionen mit sich – das braucht viel Kraft. In der Forschung ist das anders. Zwar arbeite ich etwa gleich viele Stunden pro Woche oder sogar mehr, aber den Druck mache ich mir selbst. Ich will viel arbeiten, gute Forschung leisten und meine Themen weiterbringen. Natürlich werden bei guten Forschungsarbeiten auch eher Gelder zur Verfügung gestellt. Ob meine Arbeitssituation gesund ist, weiss ich nicht – aktuell ist sie erfüllend. Meiner Meinung nach sollte man nicht auf die Stunden schauen, sondern auf den Stresspegel – und darauf, ob man noch gut schläft und seine Freizeit als befriedigend empfindet. Ich sage immer: ‘Wenn ich am Wochenende nicht mehr zwei Stunden Fahrrad fahren will, dann ist die Situation dekompensiert.’ Der Rest wird sich zeigen, wenn ich 65 Jahre alt bin.
Du hast zwei Töchter. Wie bringst du das Leben als Vater mit deinem Arbeitspensum in Einklang?
Dank Corona und Homeoffice konnte ich als Forscher in letzter Zeit zuhause präsenter sein und ich habe beispielsweise die Mädchen in die Schule gebracht. Aber ehrlich gesagt leben meine Partnerin und ich schon eher die klassische Rollenverteilung, zumindest was die Arbeitspensen angeht: Sie kümmert sich deutlich mehr um die Kinder, auch wenn das so gar nicht meiner politischen Haltung entspricht. Unsere Fragen zum Rollenmodell und zur Arbeitszeit haben wir vor der Familienplanung offen diskutiert. Es war klar, dass wir unterschiedliche Karriere-Absichten hatten, und auch, dass wir beide zugunsten der Familie gewisse Kompromisse machen würden.
Ist eine Karriere als Forscher:in schwer mit einer Familie vereinbar?
Es kommt wohl ganz auf die Partnerschaft an. Wenn beide akademische Ambitionen oder eine getaktete Karriere im Sinn haben, stelle ich mir die Organisation des Familienlebens eher schwierig vor. Wahrscheinlich geht es kaum, ohne dass eine Person zurücksteht. Plant man eine Forscherkarriere, muss man als Paar darüber sprechen, was das bedeutet: Viel Arbeit, längere Auslandsaufenthalte und allenfalls Karriere-Einbussen – zumindest bei eine:r der beiden Partner:innen.
War die Familie ein Nachteil für deine Karriere als Forscher?
Ein mindestens zwölfmonatiger Forschungsaufenthalt im Ausland gilt meines Wissens bei den meisten Universitäten als Habilitationskriterium. Ohne Familie hätte ich ziemlich sicher mehr Zeit im Ausland verbracht. Meinem Lebenslauf sieht man die familiäre Situation nicht an. Kinderlose Kolleg:innen haben vielleicht eine etwas längere Publikationsliste. Während der Pandemie und im Homeoffice hatten Forscher:innen mit Kindern sicherlich Nachteile, da man kaum ungestört und konzentriert arbeiten konnte. Der grösste Unterschied ist wohl, dass kinderlose Kolleg:innen sich besser erholen und ausgehen können.
Deine Kinder wurden direkt im Anschluss an dein Studium geboren. Ein guter Zeitpunkt?
Ich hatte früh Kinder, unter anderem, weil meine Partnerin etwas älter ist als ich. Wenn ich an meine Forschungskarriere denke, war es in vielen Aspekten ein guter Zeitpunkt. Im PhD, beziehungsweise jetzt im Postdoctoral Fellowship, hat man flexiblere und freier planbare Arbeitstage. Wahrscheinlich bin ich jetzt zu Hause präsenter als in den klinischen Jahren. Ich konnte bereits viele Beziehungen zu internationalen Forscher:innen aufbauen und falls ich einmal ein eigenes Labor habe, sind meine Kinder schon fast selbstständig.
Wie sieht dein durchschnittlicher Tag aus? Was sind die besonderen Herausforderungen deines Fachgebiets? Was ist besonders toll?
Als Forscher teile ich meine Tage selbst ein. Ich arbeite nicht schnell, dafür gründlich. Die Intensität ist etwas tiefer als in der Klinik. Nachdem ich abends die Kinder zu Bett gebracht habe, arbeite ich meist noch eine oder zwei Stunden weiter – dadurch komme ich auf ein Pensum von zehn bis vierzehn Stunden pro Tag. Am Wochenende schaue ich oft im Labor vorbei, denn es gibt fast immer etwas zu tun. Natürlich fordert das sehr viel Flexibilität von meiner Partnerin.
Was rätst du jüngeren Kolleg:innen, die einen ähnlichen Weg gehen wollen?
Besonders wichtig für mich war es, mich frühzeitig bezüglich des MD PhDs zu informieren, bereits im Studium Labor-Erfahrungen zu sammeln und Einblicke in die Forschungswelt zu gewinnen. Seid mutig, sucht Kontakte in andere Laboratorien, zum Beispiel im Ausland. Die Welt wartet nicht auf uns.
Wenn ich zu einem Thema forschen will, muss ich mich selbstständig darum kümmern, mich weiterbilden und die nötigen Kontakte zu Forscher:innen oder Laboratorien knüpfen.
Macht Papers nicht für eine Habilitation, forscht aus Freude an der Sache.
Seid flexibel und ändert auch mal einen Plan – manchmal ist Option B am Ende die bessere. Und besprecht das Ganze frühzeitig mit eurem Partner oder eurer Partnerin. Ihr werdet viel arbeiten, ihr werdet mindestens einen Auslandsaufenthalt brauchen, eure Arbeit wird eure Beziehung und die Familiensituation massgeblich prägen.
Wo willst du in zehn Jahren stehen?
Ich möchte Klinik und Forschung in meiner Arbeit kombinieren und an einer Universitätsklinik arbeiten. Mein Ziel wäre, ein kleines eigenes Labor zu haben und Forschungsgelder für eigene Themen zu bekommen. Ich werde wohl irgendwann habilitieren, wobei meiner Ansicht die Habilitation nicht das Ziel, sondern die Folge guter Forschung und spannender Arbeit ist.


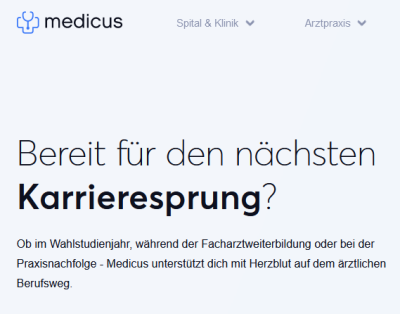
Kommentare
Noch kein Kommentar veröffentlicht.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion