
Interview mit Mariana Marti
Mariana Marti, 31-jährig, verheiratet, arbeitet aktuell 100 Stellenprozent als Assistenzärztin auf der Infektiologie und Spitalhygiene am Inselspital, Universitätsspital Bern. Sie steht kurz vor dem Abschluss des Masters in Public Health (MPH) und dem Erhalt des Facharzttitels für Allgemeine Innere Medizin.
30.05.2022
Warum hast du dich für ein Studium der Medizin entschieden?
Die Themen der Medizin haben mich schon immer interessiert. Medizin ist so relevant im Alltag. Mich fasziniert der Körper, wie ein Mensch funktioniert, wie das Leben funktioniert… Ausserdem war der soziale Aspekt – das Helfen, das Sinnstiftende – auch ein wichtiges Argument für die Wahl des Studiums.
Welchen Facharzttitel wolltest du während des Studiums wählen?
Während des Studiums hatte ich immer gehofft, dass irgendwann dieser “Aha”-Moment kommt und ich mich dann für eine Fachrichtung entscheiden kann. Dieser Moment blieb allerdings aus. Für die Innere Medizin habe ich mich schon immer interessiert, insbesondere weil sie den Menschen ganzheitlich betrachtet. Zudem habe ich mir noch Gynäkologie überlegt, vor allem wegen der Geburtshilfe.
Gab es einen bestimmten Moment, in dem du dich dann anders entschieden hast?
Ich habe dann auf der Inneren Medizin begonnen, da sie eine gute Basis ist. Und ich habe gehofft, dass ich irgendwann ganz überzeugt sein werde, entweder von der Inneren Medizin oder von einem anderen Facharzttitel. Aber leider kam dieser “Aha”-Moment lange nicht. Ich musste merken, dass ich im beruflichen Alltag nicht so zufrieden bin, wie ich es mir gewünscht hatte und es wurde mir bewusst, dass ich etwas ändern wollte.
Es dauerte einige Zeit, bis ich wusste, was genau mir fehlte. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich vor allem längerfristige Projekte und Ziele vermisse. Auch war ich mir nicht sicher, ob mir der klinische Alltag wirklich entspricht. Deshalb habe ich viel im Internet recherchiert und mit verschiedenen Leuten gesprochen, um herauszufinden, was man mit einem Medizinstudium ausserhalb der Klinik noch tun könnte. Am meisten haben mich die Forschung oder die Projektarbeit in der Entwicklungshilfe angesprochen. Und immer wieder bin ich auf das Public-Health-Studium gestossen.
Dabei bin ich auf den Lebenslauf einer Ärztin aufmerksam geworden, der mich sehr angesprochen hat. Ich hab mich dann bei ihr gemeldet und sie um ein Treffen gebeten. Wir haben uns getroffen und sie hat mir von ihrer Laufbahn erzählt und meine Fragen beantwortet.
Zur weiteren Entscheidungsfindung habe ich mich beim vsao-Programm “Coach My Career” angemeldet. Ich konnte sehr von den Gesprächen mit den Coaches profitieren und sie haben mich motiviert, auch einen etwas weniger “konventionellen Weg” zu wagen. Deshalb habe ich mich dann dafür entschieden, Public Health zu studieren und gleichzeitig einmal auszuprobieren, wie es ist, “nicht-klinisch” zu arbeiten. Mein Praktikum beim Hauptsitz vom Schweizerischen Roten Kreuz im Bereich Gesundheit und Migration hat mir sehr gefallen.
Was faszinierte dich an der Ärztin, die du getroffen hast?
Ihr Lebenslauf hat mich sehr angesprochen und mir einen möglichen Weg aufgezeigt: Sie hat zuerst als Assistenzärztin in mehreren Fachgebieten gearbeitet, war dann mit NGOs auf Auslandseinsätzen, hat Public Health studiert und im Verlauf dessen bei verschiedensten Projekten im In- und Ausland mitgewirkt. Aktuell ist sie Gutachterin und Projektleiterin für Public-Health-Themen.
Was fehlte dir am klinischen Alltag?
Was mir persönlich am meisten gefehlt hat, waren längerfristige Ziele und Projekte sowie auch etwas mehr Flexibilität im Alltag. Zudem hatte ich Mühe mit der vielen administrativen Arbeit und dem Zeitdruck. Oft hatte ich das Gefühl, dass ich mir nicht genügend Zeit für die Patient:innen nehmen konnte, obwohl ich stundenlang arbeitete. Auch die Freizeit kam zu kurz.
War es als Oberärztin anders?
Ja, die positiven Aspekte der klinischen Arbeit haben deutlich zugenommen. Ich hatte mehr Zeit zum Nachlesen, konnte mich intensiver mit den Krankheitsbildern beschäftigen und gezielt bei den Patient:innen vorbeischauen. Auch die Zusammenarbeit mit den Assistenzärzt:innen habe ich sehr geschätzt. Aufgrund der 80%-Anstellung hatte ich auch mehr Zeit für Dinge ausserhalb des Berufs.
Wie konntest du von «Coach my Career» profitieren? Was habt ihr dort gemacht?
«Coach my Career» organisiert Coaching-Gespräche mit erfahrenen Ärzt:innen. Wir haben uns zusammengesetzt und ich erzählte zuerst von meinem Werdegang, meinen Zweifeln und meinen Ideen. Danach haben die beiden Coaches von ihren Lebensläufen erzählt, was sie ausprobiert haben und wo sie aktuell stehen. In der anschliessenden Diskussion machten sie mir zahlreiche konkrete Vorschläge und wir tauschten Ideen aus.
Für mich war es sehr motivierend, dass es viele Lebens- und Berufswege gibt, die ich bisher nicht «auf dem Schirm» hatte und dass es sich lohnt, etwas anderes zu wagen und auszuprobieren.
Wie gut konnten die Coaches auf deine persönliche Situation eingehen?
Bei der Anmeldung zu «Coach my Career» gibt man an, wo man steht, welche Interessen man hat und welche Fragen man mitbringt. Dementsprechend werden die Coaches ausgewählt. Natürlich passt es nicht immer 1:1, aber das macht es ja auch spannend. Meine beiden Coaches haben neben der klinischen Arbeit auch nicht-klinisch gearbeitet und das war genau das, was mich interessierte. Von ihren Erfahrungen konnte ich sehr profitieren. Bei Bedarf kann man sich später auch nochmals mit ihnen treffen und das Gespräch vertiefen.
Wie hast du deine Arbeit bei Medseek erlebt?
Für mich war es eine positive Erfahrung. Man springt jeweils dort ein, wo Personalmangel herrscht und es kam mir viel Wertschätzung entgegen. Medseek ist toll, um flexibel arbeiten zu können, verschiedene Spitäler und Praxen kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln. Bei mir kam dazu, dass ich etwas weniger Stellenprozent arbeiten und mir damit das Studium finanzieren konnte.
Was machst du an den Studientagen?
Aktuell schliesse ich meine Masterarbeit ab und besuche keine Module mehr. Im MPH-Studium kann man wählen, welche und wie viele Module man pro Jahr besuchen möchte. Die Module finden an verschiedene Orten – in Bern, Basel oder Zürich – statt. Ein Modul dauert zwei bis sechs Tage. Weil die Teilnehmenden aus der ganzen Schweiz anreisen, beginnt der Tag meistens um 9 Uhr. Morgens sind drei, vier Vorlesungen angesetzt, dann eine Stunde Mittagspause und nochmals so viele Vorlesungen am Nachmittag. Bei einigen Modulen gibt es viel vorzubereiten, viel zu lesen. Bei anderen gibt es mehr Nacharbeiten in Form einer schriftlichen Arbeit oder einer Prüfung. Die Studientage waren somit sehr abwechslungsreich und unterschiedlich. Besonders spannend ist jeweils der Austausch mit den Mitstudent:innen und den Dozent:innen, da alle aus verschiedenen Fachbereichen kommen und anderes Wissen und andere Erfahrungen mitbringen.
Welche Zukunftsperspektiven bietet dir das Public-Health-Studium?
Public Health ist ja kein eigener Beruf, sondern ein breites Fachgebiet, welches sich gesamtheitlich mit der Gesundheit der Bevölkerung beschäftigt. Das Studium bietet ein gutes Basiswissen über die verschiedenen Bereiche des Gesundheitssystems.
Gerade wenn man Medizin und Public Health studiert hat, stehen einem sehr viele Möglichkeiten offen, wie zum Beispiel beim Kantonsarztamt, beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), bei nationalen und internationalen NGOs, in der Politik oder in der Forschung.
Wie hast du deine Stellen geplant?
Bei der Stellenplanung gibt es zwei Optionen: Entweder man plant früh im Voraus oder man bewirbt sich kurzfristig. Wenn man flexibel ist und nicht unbedingt eine bestimmte Stelle möchte, sind auch kurzfristig immer wieder Stellen frei. Ich selber habe jeweils weit im Voraus geplant. Ich habe im Wahlstudienjahr an verschiedenen Orten gearbeitet und mich dann dort beworben, wo es mir gut gefallen hat. Im Verlauf hat mir der Austausch mit Arbeitskolleg:innen sehr geholfen, die mir Stellen empfohlen haben.
Deine aktuelle Stelle ist in der Infektiologie am Inselspital. Wie hast du das eingefädelt?
Auch hier habe ich mich weit im Voraus blind beworben, kurz nachdem ich mich fürs Public-Health-Studium angemeldet hatte. Ich denke, dass dies ein Vorteil für mich war, da das Studium auch viele infektiologische Themen beinhaltet (Impfungen, Epidemien etc.) und ich mich damit von den anderen Bewerber:innen abheben konnte.
Du hast bereits sehr früh angefangen Teilzeit zu arbeiten. Wie ging es dir damit?
Ich wollte nach drei Jahren Vollzeitarbeit etwas ändern. Im Jahr 2019 habe ich Verschiedenes ausprobiert: Ich habe das Public Health Studium begonnen, ein Praktikum beim Schweizerischen Roten Kreuz gemacht und bei Medseek gearbeitet. Danach habe ich mit einer 80-Prozent-Anstellung auf dem Notfall des Inselspitals begonnen. Mit der Teilzeitarbeit hat mir dann auch die klinische Arbeit wieder viel besser gefallen!
Was eine “gute” Work-Life-Balance ist, ist wohl sehr individuell und ich gehe davon aus, dass viele Kolleg:innen länger auf dem Beruf bleiben würden, hätten sie die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten.
Musstest du verhandeln, um Teilzeit zu arbeiten, oder ging das reibungslos?
Nein, ich wurde beim Bewerbungsgespräch am Universitären Notfallzentrum in Bern direkt gefragt, wie viele Stellenprozent ich arbeiten möchte – das ist aber wohl die Ausnahme. Es ist einfacher, wenn man einen Grund angibt, weshalb man Teilzeit arbeiten möchte – bei mir war es das Studium.
Wie war das bei dir mit der maximalen Soll-Arbeitszeit? Durch die Doppelbelastung von Beruf und Studium hast du sicherlich mehr gearbeitet?
In den ersten drei Assistenzjahren mit 100 Stellenprozent habe ich viele Überstunden gemacht und war häufig am Anschlag. Sobald ich mit der Teilzeitarbeit begonnen habe, habe ich weniger Überstunden gemacht. Ich weiss nicht genau, woran das lang. Einerseits natürlich an der Erfahrung und dass ich speditiver wurde, andererseits hatte ich aber auch mehr Motivation und Energie für die Arbeit. Natürlich war die Doppelbelastung mit dem Studium manchmal auch anstrengend, aber ich habe die Stunden, die ich fürs Studium investierte, als weniger belastend empfunden.
Zu viele Überstunden führen oft zu Depressionen oder Burnout. Hast du das auch so erlebt?
Ja, ich habe das auch erlebt. An jeder meiner Arbeitsstellen sind Kolleg:innen wegen Burnout oder Depressionen ausgefallen – Männer wie Frauen. Die klinische Arbeit und die Überstunden sind häufig schon sehr belastend und es hat mich erschreckt, wie viele Ärzt:innen darunter leiden.
Wie bringst du Beruf, Familie und Freizeit unter einen Hut?
Ich bringe es auch noch nicht immer gut unter einen Hut. Aber es hilft mir, wenn ich am Abend einen Termin plane, so dass ich gezwungen bin, mit der Arbeit aufzuhören. Das ist allerdings einfacher gesagt als getan (lacht). Manchmal könnte ich am Abend ewig weiterarbeiten.
Wenn du zurückschaust, würdest du wieder die gleichen Entscheidungen treffen?
Ich finde, im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, man würde etwas anders machen wollen. Deshalb sage ich mal, dass ich mehr oder weniger alles gleich machen würde.
Eines würde ich mir aber schon für die Berufswahl und die Schulzeit wünschen: Dass man früher gefördert wird beim Entdecken, was man wirklich gern macht – und zwar nicht, was man theoretisch spannend findet, sondern welche Tätigkeiten einem in der Praxis wirklich Freude bereiten. Ich fand als Schülerin sehr viele Themen spannend – habe mir aber nicht überlegt, welcher Berufsalltag mir konkret gefallen und entsprechen würde – also zum Beispiel, wie viel Sozialkontakt mir wichtig ist oder wie viel Bewegung, wie viel Zeit vor dem Bildschirm. Oder ob mir eher eine Arbeit mit kurzfristigen Zielen gefällt, die am Abend grösstenteils abgeschlossen sind oder ob ich motiviert bin, an längerfristigen Projekten zu arbeiten, wie viel Flexibilität im Alltag wichtig ist, ob man Teilzeit arbeiten kann und so weiter.
Alle diese Aspekte sind, neben den persönlichen Interessen, sehr wichtig für die Berufswahl.
Worüber sollten deine jüngeren Kolleg:innen früher nachdenken?
Wie oben schon erwähnt: Sie sollten sich früh genug überlegen, was sie wirklich glücklich macht, sich fragen, nach welchen Tätigkeiten sie zufrieden sind und welche Leidenschaften sie haben. Manchmal ist man sich dessen nämlich gar nicht so bewusst. Wenn man sich dessen aber bewusst wird, kann man versuchen, dies in den Berufsalltag und die Berufsplanung einzubauen. Mir hat das sehr geholfen, zufriedener zu werden.
Zudem ist es immer hilfreich, mit Menschen reden zu können, die dort im Berufsleben stehen, wo man selbst hin möchte.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Familie ist ein Thema, am liebsten mit zwei bis drei Kindern. Beruflich möchte ich den Facharzt für Infektiologie erlangen, Erfahrungen im Ausland sammeln und dann irgendwann an einem Projekt im Bereich Public Health und Infektiologie im In- oder Ausland arbeiten. Da bin ich noch recht offen... Ich denke, es werden die richtigen Türen auf- und zugehen und ich bin gespannt, wo ich einmal landen werde.


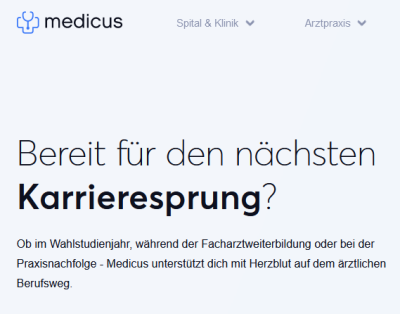
Kommentare
Noch kein Kommentar veröffentlicht.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion