
Interview mit Aude Julie Lehnen
Aude Julie Lehnen ist 30-jährig und verheiratet mit einem Elektroingenieur. Sie hat bisher immer Vollzeit gearbeitet. Aktuell ist sie am Spitalzentrum Biel tätig, um den vollständigen Facharzttitel Chirurgie mit Spezialisierung auf Viszeralchirurgie zu erlangen.
25.04.2022
Was gefällt dir an der Medizin?
Naturwissenschaften haben mich schon immer interessiert. Und mir gefällt, dass es in meinem Beruf um eine Kombi verschiedener Wissenschaften geht. Wichtig war mir, dass es angewandte Wissenschaften sind, bei denen man sich auch schon vorstellen kann, wie der Beruf schlussendlich aussieht. Auch wenn man am Anfang nicht wirklich weiss, was es bedeutet, Ärztin zu sein… Ab dem Blockpraktikum war ich dann richtig begeistert von der Chirurgie. Bis dahin war ich eher unsicher, ob Medizin wirklich die richtige Wahl für mich ist.
Welchen Facharzttitel wolltest du während des Studiums machen?
Was ich nicht machen wollte wusste ich immer – vor allem wollte ich nicht in die Gynäkologie, in die plastische Chirurgie oder in die Chirurgie. Ich dachte immer, es wird wohl eher so etwas wie Endokrinologie oder Neurologie, denn das hat mich im Studium am meisten interessiert. Im Blockpraktikum bin ich in der plastischen Chirurgie gelandet und dort hat es mir wider Erwarten so gut gefallen, dass mir klar wurde: Ich will in ein chirurgisches Fach. Schlussendlich fand ich die Abwechslung und die manuelle Arbeit in der Chirurgie einfach super, genauso wie die Stimmung im Ops und im Team. Solche Entscheidungen sind sicherlich sehr team- und typenabhängig.
Was gefällt dir besonders gut? Und welches sind die grössten Herausforderungen?
Vor allem die Abwechslung ist toll. Man hat sowohl die intellektuelle Herausforderung, muss die Krankheitsbilder kennen, wissen, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und wann es eine Indikation zur Operation gibt – das ist ja fast das Wichtigste in der Chirurgie. In Abwechslung dazu gibt es den manuellen Teil, in dem man intellektuell anders gefordert ist.
Assistenzärzt:innen sind entweder auf dem Notfall tätig – dort werden chirurgische Notfälle behandelt und hin und wieder auch Indikationen gestellt – oder sie sind auf der Station für die Visite der Patient:innen zuständig. In den meisten Kliniken arbeitet man auch im Operationssaal, wo man entweder assistiert oder selbst Operationen durchführt. In manchen Kliniken hat man bereits als Assistenzärzt:in Sprechstunden. Das wird ja später die Hauptaufgabe als Oberärzt:in, dass man eigene Patient:innen betreut, operiert und für das Follow-up zuständig ist. So bekommt man auch den ganzen Verlauf der Patient:innen zu sehen.
Die grösste Herausforderung ist die Organisation – und das bleibt auf allen Stufen so. Einerseits muss man seinen Tag antizipieren und die Station gut kennen. Welche Patient:innen liegen dort? Gab es in der Nacht Probleme? Welche Probleme muss man noch lösen, bevor man in den Ops geht und die Pflegenden dann für mehrere Stunden keine Ansprechperson haben? Oft kommt es vor, dass Problemfälle das ganze Programm auf den Kopf stellen und man den Tag umplanen muss. Oberärzt:innen müssen oft und überraschend einspringen. Diese Spontanität wird einen das ganze Arbeitsleben lang begleiten.
Wie hast du deine Stellen geplant? Wie hast du dich informiert?
Da bin ich vielleicht nicht so das Vorzeigebeispiel. In Langenthal habe ich nach dem Wahlstudium angefangen, weil Studienkolleg:innen mir erzählt hatten, dass ihr Blockpraktium dort cool gewesen sei. Also habe ich mir das angeschaut und bin so an die Assistent:innenstelle gekommen. Die weiteren Stellen habe ich relativ kurzfristig geplant und meinem Wohnort entsprechend angepasst – damals habe ich in Zürich gewohnt. Wieder habe ich Kolleg:innen gefragt, ob sie Erfahrung mit Spitälern im Umkreis hätten und habe mir im SIWF-Register die Bewertungen angeschaut. Auch die Entscheidung für die Zeit in Biel lief ähnlich: Einer Freundin von mir hat es dort super gefallen, sie hat sich im Team sehr wohl gefühlt und deshalb habe ich mich dort beworben.
Was gibt es zur Work-Life-Balance zu sagen? Und wie stehst du zu Teilzeit?
In der Chirurgie ist es in der Assistenzzeit schwieriger, Teilzeit zu arbeiten. Von vielen hört man, es sei nicht so gut möglich – obwohl ich gar nicht weiss, was denn die Spitäler dazu sagen. Es ist einfach unüblich. Ich persönlich würde es nicht empfehlen, weil man in der Chirurgie bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen muss. Wenn bestimmte Abläufe in kurzer Zeit häufiger repetiert werden, festigt sich das Wissen besser. Es ist sicher einfacher, wenn man, bis sich die Basics gefestigt haben,100 Prozent arbeitet. Bisher habe ich erst zweimal erlebt, dass Assistent:innen Teilzeit gearbeitet haben. Eine Kollegin war am Ende der Ausbildung, was natürlich wesentlich einfacher war. Im anderen Fall wollte sie den Facharzt nicht in der Chirurgie abschliessen. Alle anderen haben Vollzeit gearbeitet. Teilzeit ist oft eine organisatorische Herausforderung, aber das heisst nicht, dass es nicht möglich wäre. Am einfachsten ist Teilzeit umsetzbar, wenn man sich eine Stelle mit jemandem teilt.
Hast du deine Soll-Arbeitszeit häufig überschritten? Wenn ja, hast du dich gewehrt?
Ja, ich habe die Soll-Arbeitszeit immer wieder überschritten. Das erlebt wohl jede:r. Ich konnte aber meine Überstunden immer aufschreiben und kompensieren. In der Chirurgie ist saisonabhängig mal mehr und mal weniger los – wenn weniger läuft, kann man auch mal kompensieren. Es gab durchaus Zeiten, in denen ich am Limit war, aber gewehrt habe ich mich nie. Man muss sich bewusst sein, dass man in der Chirurgie abhängig von den Vorgesetzten ist.
War das psychisch und physisch immer gesund?
Ich habe meine Freizeitaktivitäten auf ein Minimum reduziert und viel geschlafen. Physische Probleme hatte ich nie, es war wohl eher psychisch phasenweise zu viel. Das fällt in der Regel erst im Rückblick auf. Mir hat es in diesen belastenden Phasen geholfen, mich zurückzuziehen, aber das ist wohl bei jeder und jedem anders. Im Zweifelsfall muss man halt die Notbremse ziehen, sich selbst an die erste Stelle stellen und sich zum Beispiel krankschreiben lassen. Ich war in diesen Zeiten sehr müde und konnte keinen Extra-Effort mehr leisten, ich konnte meine Arbeit machen, aber nicht mehr. Im Nachhinein war mir dann klar, dass es damals wohl einfach zu viel für mich war. Eigentlich leiste ich gerne mal etwas mehr, als es braucht. Ich bin auch gerne noch abends in den Ops gegangen, wenn es etwas Neues gab, obwohl ich wusste, dass es spät werden würde. In der Zeit, in der ich am Limit lief, konnte ich das nicht mehr, dann war es mir auch egal, ob noch etwas Spannendes zu lernen wäre. Damals wollte ich einfach nur noch heim.
Wie bringst du Freizeit, Familie und Beruf unter einen Hut?
An Arbeitstagen mit Stationsbetrieb ist man einfach so lange da, bis die Arbeit erledigt ist – durchschnittlich sind das wohl 12 Stunden Arbeitszeit. Wenn ich danach zuhause bin, verbringe ich Zeit mit meinem Mann, der zum Glück kein Mediziner ist und sehr flexible Arbeitszeiten hat. Dadurch haben wir genügend Zeit füreinander. Die Arbeitstage im Notfall sind je nach Spital weniger lang. Dadurch bleibt dann mehr Zeit für Entspannung. An meinen freien Tagen chille ich oder habe viel Programm, je nach Lust und Laune. Aber ja – während der Arbeitswoche ist die Work-Life-Balance nicht besonders super. Es kommt sicherlich auch sehr darauf an, wie gross das persönliche Schlafbedürfnis ist. Für mich ist genügend Schlaf sehr wichtig, denn ich will am nächsten Tag fit sein und achte darauf, dass ich mindestens sieben Stunden schlafe. Viele Kollegen brauchen nicht so viel Schlaf und haben dann abends noch Zeit für Sport oder anderes. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, wie lange der Arbeitsweg ist. Ich brauche von Tür zu Tür etwa eine Stunde.
Was würdest du heute wieder so machen und was anders?
Die Chirurgie würde ich wieder wählen, aber es gibt bei der Stellenplanung Aspekte, die ich anders machen würde. Zum Beispiel mehr Zeit an einer gleichen A-Klinik verbringen, weil die Lehre dort einheitlich geregelt ist. An kleinen Spitälern will es jede leitende Person anders machen, was für die Lernenden schwieriger ist. Die einheitliche Lehre macht es auch einfacher, sich einen funktionierenden Behandlungsplan aufzustellen. Ich würde auch nicht zu viele Stellenwechsel einplanen, lieber drei bis vier Jahre in der gleichen A-Klinik bleiben, damit ich nicht immer wieder von vorne anfangen müsste, die Leute neu kennenlernen, mich positionieren... In der Chirurgie muss man allerdings mindestens einmal die Stelle wechseln und mindestens ein Jahr in einer B-Klinik arbeiten. Alternativ gibt es Netzwerke, zum Beispiel im Raum Zürich ein Chirurgie-Netzwerk, bei denen man sich bewerben kann und die einen dann einteilen. Sie stellen einen Plan zusammen – zum Beispiel ein Jahr in dieser und ein Jahr in jener Klinik. Das kann sicherlich sehr hilfreich sein. Man benötigt einfach eine gewissen Flexibilität, auch was den Wohnsitz angeht. Für mich waren Netzwerke nicht die richtige Wahl, weil ich nicht umziehen oder weit pendeln wollte und weil es mir lieber war, länger am gleichen Spital zu bleiben.
Zu Beginn war mir nicht klar, wie wichtig die Positionierung und das Networken in der Chirurgie sind. Das ist sicherlich in anderen Fächern auch so, aber in der Chirurgie ist man besonders abhängig davon, dass dich jemand anleitet und dir Schritt für Schritt zeigt, wie man etwas macht. Dazu sollte man dich ein wenig kennen, die Vorgesetzten sollten wissen, was du schon kannst, was nicht. Das habe ich unterschätzt.
Welche Ratschläge würdest du jüngeren Kolleg:innen geben?
In der Chirurgie ist es ein wenig wie in der Politik: du solltest nicht negativ auffallen und mit allen gut auskommen, denn du bist darauf angewiesen, dass du bestimmte Operationen durchführen darfst. Positionieren umfasst allerdings noch mehr - andere sind gleich weit wie du, sie brauchen die gleichen Eingriffe – da ergibt sich eine gewisse Konkurrenz. Falls man darauf Einfluss nehmen kann, ist es sinnvoll zu schauen, dass an einer Stelle nicht zu viele auf dem gleichen Ausbildungslevel unterwegs sind und die gleichen Eingriffe benötigen. Und man muss sich spezialisieren, eine Nische suchen – zumindest, wenn man aus dem normalen Dienstbetrieb herauskommen möchte. Ohne Spezialgebiet wird man immer Nachtdienste abdecken müssen. Es ist also das Ziel, sich auf gewisse Weise unentbehrlich zu machen. Wenn man zum Beispiel im Spital der einzige Proktologe ist, braucht es einen im Tagdienst und in den Sprechstunden. Somit hat man weniger Dienstbetrieb und man kommt auch schneller in eine Kaderposition – für diejenigen, die Karriere machen wollen.
Was gibt es für Tipps rund um das Logbuch? Wie kriegt man es gefüllt, ohne zu fest konkurrieren zu müssen?
Ich musste mich nie asozial verhalten, um mein Logbuch zu füllen. In kleineren Spitälern ist man im zweiten Jahr schon etwas erfahren und kommt zum Operieren. Wenn es für einen nicht gut läuft in einer Klinik, weil es zum Beispiel zu viele Assistent:innen gibt, weil sie wenig operieren oder Assistent:innen gar nicht viel operieren dürfen, sollte man vielleicht die Klinik wechseln oder das Problem mit den Kolleg:innen besprechen. Auch da, wo ich jetzt arbeite, gab es nie einen wirklichen Konkurrenzkampf. Früher oder später kann man sein Logbuch füllen. Dabei können auch wieder die Netzwerke helfen – sie garantieren, dass man innerhalb von sechs Jahren den Facharzt abschliessen kann und helfen dabei, den Katalog zu füllen.
Das Logbuch unterschätzt man am Anfang. Es ist wichtig, sich bei den Kolleg:innen frühzeitig darüber zu informieren – zum Beispiel, welches die wichtigen Kurse sind, die man möglichst bald belegen sollte. Das Basisexamen ist so ein Fall oder der ATLS-Kurs, damit man im Schockraum Patient:innen betreuen kann. Am besten stellt man sich einen Plan zusammen, wann man sinnvollerweise welche Weiterbildungen absolvieren will. Für den Facharzt sollte man viele Kurse und Kongresse besucht haben, das kann man nicht alles in die letzten drei Jahre quetschen. Bei dieser Planung können erfahrene Kolleg:innen helfen. Infos dazu gibt es auch auf der Webseite des SIWF. Aber auch dann, wenn der Plan sich nicht genau so umsetzen lässt wie geplant, sollte man nicht den Mut verlieren und vor allem nicht die Freude am Operieren!
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Ich hoffe, dass ich in 10 Jahren noch immer viel Freunde an meinem Beruf habe und im Ops Gutes tue!


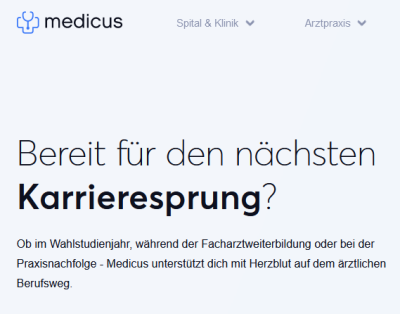
Kommentare
Noch kein Kommentar veröffentlicht.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion